
Wer kennt es nicht: Probleme mit dem Kreislauf. Zu hoher Blutdruck, zu niedriger Blutdruck… Von lästig bis gefährlich und dringend behandlungsbedürftig reichen die Beschwerden. Hoher Blutdruck ist ein Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall, also gefährlich. Stark erhöhter Blutdruck gehört also in ärztliche Behandlung. Allerdings helfen Pillen allein oft weniger gut als erwartet, und haben häufig Nebenwirkungen. Deshalb sollte man versuchen, den Blutdruck gar nicht erst aufs gefährliche, behandlungsbedürftige Maß steigen zu lassen, beziehungsweise ihn langfristig wieder ohne Medikamente in den Griff zu bekommen. Medikamente sind also eine Notfall-, keine Dauerlösung. Leistungssport und Dauerdiät sind für eine Senkung des Blutdrucks nicht notwendig, stattdessen kleine, aber wirksame Veränderungen im Alltag. Denn auch bei hohem Blutdruck (Werte über 140/90) gibt es neben den Medikamenten natürliche Hilfe.
Niedriger Blutdruck (Werte unter 100/60) ist auch ein Thema für sich. Zwar ist niedriger Blutdruck weniger gefährlich als hoher, aber er zieht einen Schwanz unangenehmer Beschwerden nach sich. Schwindel beim Aufstehen, Schlappheit den ganzen Tag, Konzentrationsschwäche… Wer niedrigen Blutdruck hat, leidet oft auch noch unter kalten Händen und Füßen. Natürlich muss niedriger Blutdruck, der sich mit deutlichen Symptomen äußert, auch ärztlich untersucht werden, um auszuschließen, dass eine ernste Krankheit dahinter steckt, doch das ist extrem selten, meist lässt sich keine konkrete Ursache finden. Niedriger Blutdruck ist ein häufiges Problem junger Frauen, ohne dabei eine Krankheit darzustellen. Aber ob ungefährlich oder nicht, die Beschwerden sind da. Doch auch hier bietet sich schonende, natürliche Hilfe an.
Mehr Bewegung im Alltag
Dass man bei hohem Blutdruck gesünder essen und sich mehr bewegen sollte, hat jeder Bluthochdruckpatient schon einmal gehört. Tatsächlich sind Veränderungen leichter zu bewirken, als man denkt. Beim Thema Bewegung muss es nicht gelingen, jede Woche viermal eine halbe Stunde durch den Park zu joggen, wenn man komplett unsportlich ist. Sparen Sie sich doch einfach öfters mal den Stau und die Parkplatzsuche, nehmen Sie für kleine Wege das Fahrrad. Regelmäßige, stramme Spaziergänge, so lang, wie es Ihnen gefällt, können Sie zwischendurch einbauen, wenn sich keine Gelegenheiten bieten, aus lästigen Fahrtwegen Nutzen für Ihre Gesundheit zu ziehen. Es kommt also einfach auf etwas mehr Bewegung im Alltag an, öfters Fahrrad statt Auto, mal wieder spazieren gehen, Treppe statt Aufzug… Und wenn Sie Spaß daran haben, ist auch jede Sportart geeignet, solange sie keine Überlastung bedeutet. Also Radfahren, Schwimmen, auch Tanzen…
Gesunde Ernährung ist wichtig bei hohem Blutdruck – Und ganz einfach
Wie eine gesunde Ernährung im Idealfall aussieht, weiß wohl fast jeder, und auch, dass sie zu hundert Prozent meistens nicht zu realisieren ist. Also, was tun? Kleine Veränderung, große Verbesserung. Übergewicht und ungesunde Fette treiben den Blutdruck nach oben. Also versuchen Sie, unnötigem Fett. Zucker und zuviel Kochsalz aus dem Weg zu gehen. Das heißt nicht, auf alles verzichten. Aber der Schokoriegel, den man sich nicht als Genuss, sondern um schnell satt zu werden, reinschiebt, kann auch durch eine Banane ersetzt werden. Die enthält auch natürlichen Zucker, aber kein verstecktes, ungesundes Fett.
Gerade im Sommer sind süße Früchte die beste Nascherei, Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren und Co. sagte man gesundheitsfördernde Wirkungen nach, denken Sie auch an Melonen und das Herbstobst wie Pflaumen und die Mirabellen im August. Im Winter gibt es Mandarinen, Äpfel, Banane, Kiwi, Ananas… Saisonobst ist nicht nur preiswerter, sondern auch oft von höherer Qualität. Das Gleiche gilt für Gemüse. Ist die Zeit knapp oder die Lust zum Kochen nicht da, kann man statt eine Büchse zu öffnen oder einen Hamburger zu kaufen, auch ein belegtes Brot selbst machen. Geschmacklich kann das mit frischen Zutaten den Hamburger sogar übertrumpfen, auch wenn Geschmack natürlich „Geschmacksache“ ist. Sie kriegen „den“ Geschmack einfach nicht hin? Experimentieren Sie doch einmal mit Pommesgewürz oder Pizzagewürz, das gibt es als Gewürzmischung zu kaufen. Ideal wäre es Bio, ohne künstliche Aromen. Statt Weißbrot oder Toast kann man einfaches Graubrot oder besser noch Vollkorn bevorzugen… Es muss nicht immer perfekt sein, versuchen Sie einfach, jede Mahlzeit gesundheitlich etwas zu verbessern. Also wenn schon die fette Wurst, dann wenigstens auf Vollkornbrot, oder einen bunten Salat zur Tiefkühlpizza.
Auch bei niedrigem Blutdruck richtig essen
Bei niedrigem Blutdruck ist moderate Bewegung um den Kreislauf anzuregen und zu trainieren natürlich auch angebracht. Von zu fetter, zu reichhaltiger Nahrung wird der niedrige Blutdruck nicht ausgelöst, trotzdem ist gesunde Ernährung natürlich für jeden empfehlenswert. Allerdings tritt der niedrige Blutdruck bei sehr schlanken Personen, besonders jungen Frauen, häufiger auf. Das Mittel heißt dann natürlich nicht Fast Food und Sahnetörtchen, sondern gesunde, nahrhafte Mahlzeiten nach Geschmack. Auch Eisenmangel kann schlapp und anämisch machen, hier sackt dann auch der Blutdruck in den Keller. Viel Eisen ist in Fleisch, besonders in Innereien, aber auch in anderen Stücken, enthalten. Einen starken Mangel kann der Arzt mit Eisenpräparaten beheben.
Kneippen hält den Kreislauf fit
Zwei Maßnahmen sind sowohl bei hohem als auch bei niedrigem Blutdruck angebracht: Kneippanwendungen und Autogenes Training. Beides ist einfach in den Alltag zu integrieren. Kneippsche Anwendungen kann man nebenbei beim Duschen machen. Dazu sollte man sich für zu Hause Infos und Anleitungen besorgen, und bei stärkeren Kreislaufbeschwerden den Arzt zu Rate ziehen, welche Anwendungen geeignet sind. Hier finden Sie als Beispiel die Bürstenmassage und die Ganzwaschung, die ganz allgemein den Kreislauf trainieren.
Bürstenmassage: Mit einer Körperbürste oder einem festen Frotteehandschuh (rauer Waschlappen, kleines Handtuch) beginnen Sie außen am rechten Fuß zu bürsten, in geraden Strichen das Bein hoch, dann innen am Fuß. Weiter erst innen, dann außen jeweils am Unter- und Oberschenkel. Dasselbe beim linken Bein und danach am Gesäß. Dann fangen Sie mit dem rechten Arm an der Hand an, bürsten an der Außenseite wieder längs nach oben zur Schulter, dann an der Innenseite und rechts das Selbe. Schließlich bürsten Sie kreisförmig im Uhrzeigersinn Brust, Bauch und Rücken. Wenn Sie keine Bürste sondern ein Handtuch nehmen, rollen Sie das einfach und rubbeln Sie den Rücken wie beim Trockenrubbeln nach dem Duschen. Das Bürsten ist eine gute Morgenanwendung.
Ganzwaschung: Sie tauchen einen Waschlappen oder ein Tuch in kaltes Wasser. Dann wird der nasse Lappen zügig über die Haut gestreift, in der Reihenfolge wie beim Bürsten. Das geht sehr schnell, nur ein kleiner Wasserfilm bedeckt danach die Haut. Machen Sie hinterher zum Beispiel einige Kniebeugen und ziehen Sie sich dann warm an, um sich nicht zu erkälten. Ziel ist nicht, dass Sie frieren, nach dem „ersten Schreck“ vor dem kalten Wasser stellt sich nach der Anwendung ein Wärmegefühl ein, das zeigt den Durchblutungseffekt. Auch die Ganzwaschung ist morgens sinnvoll, wenn Sie „bettwarm“ sind.
Wollen Sie z.B. abends einen eher beruhigenden Effekt erzielen, beschränken Sie das Bürsten oder die Waschung auf den Unterkörper. Oberkörperanwendungen wirken dagegen anregend. Abends vorm Schlafengehen können Sie auch einen Schenkelguss machen – mit (erträglich, nicht eisig) kaltem Wasser wird erst das rechte, dann das linke Bein, mit dem Wasserstrahl vom Fuß außen nach oben und an der Innenseite herunter, abgegossen. Auch hier sollten die Beine vorher warm sein, z.B. durch kurze Gymnastik oder warmes Abgießen vorher.
Einfache Entspannungsmethoden wirken ausgleichend
Autogenes Training ist als Kurzform leicht zu erlernen, es gibt preiswerte Bücher zu diesem Zweck. Auch Kurse können Sinn machen. Beim Autogenen Training wird durch Entspannung und Konzentration das vegetative Nervensystem beeinflusst, das unter anderem Puls und Blutdruck steuert. Von so einer Entspannungstechnik, die sie am Tag nur weniger als zehn Minuten kostet, profitiert die gesamte Gesundheit, nicht nur der Kreislauf. Da das Erlernen so umkompliziert ist wie die tägliche Ausführung, und Ihnen zum Beispiel auch zu weniger Stress und besserem Schlaf hilft, macht das Autogene Training auf jeden Fall Sinn.
Akupressur bei hohem oder niedrigem Blutdruck
Gibt es auch Akupressurtipps für den Kreislauf? Ja. Nur bei schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Akupressur nicht angebracht.
Bei hohem Blutdruck versuchen Sie es einmal mit zwei Punkten am Handgelenk. Sie helfen, „runterzukommen“, zu entspannen:
 1. Dieser Punkt liegt auf der Handgelenksfalte, innen am Handgelenk, in einer Linie mit dem kleinen Finger. Sie können eine kleine Vertiefung tasten. Erst auf der einen, dann auf der anderen Seite einige Minuten massieren. Merken Sie sich diesen Punkt auch, wenn Sie öfters nicht schlafen können oder nervös sind, er hilft, zur Ruhe zu kommen.
1. Dieser Punkt liegt auf der Handgelenksfalte, innen am Handgelenk, in einer Linie mit dem kleinen Finger. Sie können eine kleine Vertiefung tasten. Erst auf der einen, dann auf der anderen Seite einige Minuten massieren. Merken Sie sich diesen Punkt auch, wenn Sie öfters nicht schlafen können oder nervös sind, er hilft, zur Ruhe zu kommen.
 2. Ein weiterer Punkt liegt auf der Innenseite des Unterarms, auf der Mitte zwischen den beiden hier tastbaren Sehnen. Zwei Daumenbreiten entfernt von der Beugefalte des Handgelenks. Kräftiger, massierender Druck mit dem Zeigefinger oder Daumen, auf jeder Seite 1-2 Minuten.
2. Ein weiterer Punkt liegt auf der Innenseite des Unterarms, auf der Mitte zwischen den beiden hier tastbaren Sehnen. Zwei Daumenbreiten entfernt von der Beugefalte des Handgelenks. Kräftiger, massierender Druck mit dem Zeigefinger oder Daumen, auf jeder Seite 1-2 Minuten.
Bei niedrigem Blutdruck soll der Kreislauf angeregt werden
 Akut, wenn Ihnen schwindlig wird, z.B. nach schnellem Aufstehen oder bei Hitze, oder wenn sie sich fühlen, als würden Sie „umkippen“ setzen Sie sich schnell hin und drücken Sie den Punkt zwischen Nase und Oberlippe fest mit einer Fingerkuppe für einige Minuten. Dieser Punkt stabilisiert wieder den Kreislauf.
Akut, wenn Ihnen schwindlig wird, z.B. nach schnellem Aufstehen oder bei Hitze, oder wenn sie sich fühlen, als würden Sie „umkippen“ setzen Sie sich schnell hin und drücken Sie den Punkt zwischen Nase und Oberlippe fest mit einer Fingerkuppe für einige Minuten. Dieser Punkt stabilisiert wieder den Kreislauf.
 Ein Punkt, der mehr Energie gibt und den Kreislauf stärkt, liegt am Bein. Legen Sie Ihre Hände im Sitzen, Beine im rechten Winkel gebeugt, auf die Kniescheiben. Etwa wo der Ringfinger liegt, können Sie eine Vertiefung ertasten. Möglichst an beiden Seiten zugleicht kräftig mit je einer Fingerkuppe für ein oder zwei Minuten pressen.
Ein Punkt, der mehr Energie gibt und den Kreislauf stärkt, liegt am Bein. Legen Sie Ihre Hände im Sitzen, Beine im rechten Winkel gebeugt, auf die Kniescheiben. Etwa wo der Ringfinger liegt, können Sie eine Vertiefung ertasten. Möglichst an beiden Seiten zugleicht kräftig mit je einer Fingerkuppe für ein oder zwei Minuten pressen.
Sie sehen, auch bei Problemen mit Blutdruck und Kreislauf gibt es Hilfe, die nicht aus der Chemiefabrik stammt.
Autor: Amalie für CSN – Chemical Sensitivity Network, 7. Juli 2009


 Neben der Psychotherapie ist auch die medikamentöse Therapie bei psychischen Problemen, oder was man dafür hält, heute weit verbreitet. Von deren Verfechtern erfährt der Kranke nichts über sein verdrängtes Sexualleben sondern wird über die Defizite seiner Hirnchemie aufgeklärt. Auch hier kommt ihm der kulturell gelernte Glaube an die Effektivität von Medikamenten und die Macht und Autorität der Wissenschaft zu Gute. Um derartige Effekte zu berücksichtigen, wird die Wirksamkeit in doppelt blinden Placebo Vergleichsstudien ermittelt, was bei Psychotherapien leider nicht geht. (Auf Probleme im Zusammenhang mit Nebenwirkungen soll in diesem Beitrag nicht eingegangen werden.)
Neben der Psychotherapie ist auch die medikamentöse Therapie bei psychischen Problemen, oder was man dafür hält, heute weit verbreitet. Von deren Verfechtern erfährt der Kranke nichts über sein verdrängtes Sexualleben sondern wird über die Defizite seiner Hirnchemie aufgeklärt. Auch hier kommt ihm der kulturell gelernte Glaube an die Effektivität von Medikamenten und die Macht und Autorität der Wissenschaft zu Gute. Um derartige Effekte zu berücksichtigen, wird die Wirksamkeit in doppelt blinden Placebo Vergleichsstudien ermittelt, was bei Psychotherapien leider nicht geht. (Auf Probleme im Zusammenhang mit Nebenwirkungen soll in diesem Beitrag nicht eingegangen werden.)



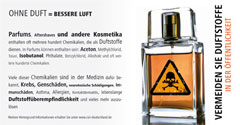


 1. Dieser Punkt liegt auf der Handgelenksfalte, innen am Handgelenk, in einer Linie mit dem kleinen Finger. Sie können eine kleine Vertiefung tasten. Erst auf der einen, dann auf der anderen Seite einige Minuten massieren. Merken Sie sich diesen Punkt auch, wenn Sie öfters nicht schlafen können oder nervös sind, er hilft, zur Ruhe zu kommen.
1. Dieser Punkt liegt auf der Handgelenksfalte, innen am Handgelenk, in einer Linie mit dem kleinen Finger. Sie können eine kleine Vertiefung tasten. Erst auf der einen, dann auf der anderen Seite einige Minuten massieren. Merken Sie sich diesen Punkt auch, wenn Sie öfters nicht schlafen können oder nervös sind, er hilft, zur Ruhe zu kommen.  2. Ein weiterer Punkt liegt auf der Innenseite des Unterarms, auf der Mitte zwischen den beiden hier tastbaren Sehnen. Zwei Daumenbreiten entfernt von der Beugefalte des Handgelenks. Kräftiger, massierender Druck mit dem Zeigefinger oder Daumen, auf jeder Seite 1-2 Minuten.
2. Ein weiterer Punkt liegt auf der Innenseite des Unterarms, auf der Mitte zwischen den beiden hier tastbaren Sehnen. Zwei Daumenbreiten entfernt von der Beugefalte des Handgelenks. Kräftiger, massierender Druck mit dem Zeigefinger oder Daumen, auf jeder Seite 1-2 Minuten. Akut, wenn Ihnen schwindlig wird, z.B. nach schnellem Aufstehen oder bei Hitze, oder wenn sie sich fühlen, als würden Sie „umkippen“ setzen Sie sich schnell hin und drücken Sie den Punkt zwischen Nase und Oberlippe fest mit einer Fingerkuppe für einige Minuten. Dieser Punkt stabilisiert wieder den Kreislauf.
Akut, wenn Ihnen schwindlig wird, z.B. nach schnellem Aufstehen oder bei Hitze, oder wenn sie sich fühlen, als würden Sie „umkippen“ setzen Sie sich schnell hin und drücken Sie den Punkt zwischen Nase und Oberlippe fest mit einer Fingerkuppe für einige Minuten. Dieser Punkt stabilisiert wieder den Kreislauf.  Ein Punkt, der mehr Energie gibt und den Kreislauf stärkt, liegt am Bein. Legen Sie Ihre Hände im Sitzen, Beine im rechten Winkel gebeugt, auf die Kniescheiben. Etwa wo der Ringfinger liegt, können Sie eine Vertiefung ertasten. Möglichst an beiden Seiten zugleicht kräftig mit je einer Fingerkuppe für ein oder zwei Minuten pressen.
Ein Punkt, der mehr Energie gibt und den Kreislauf stärkt, liegt am Bein. Legen Sie Ihre Hände im Sitzen, Beine im rechten Winkel gebeugt, auf die Kniescheiben. Etwa wo der Ringfinger liegt, können Sie eine Vertiefung ertasten. Möglichst an beiden Seiten zugleicht kräftig mit je einer Fingerkuppe für ein oder zwei Minuten pressen.

