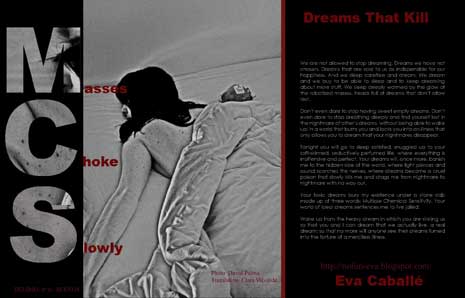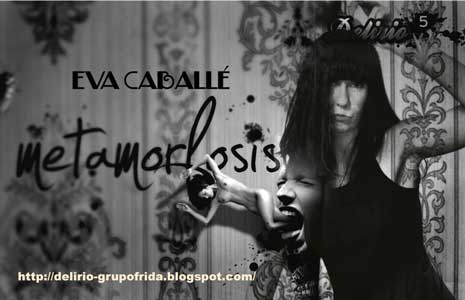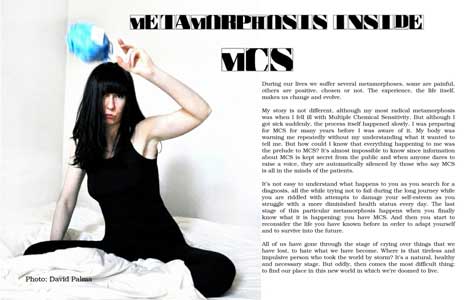Chemikaliensensible berichten häufig, dass viele Ärzte sich sträuben, MCS zu diagnostizieren. Eine ganze Reihe von Erkrankten sagt sogar, dass man ihnen ärztlicherseits mitgeteilt habe, man wüsste nicht, wie man MCS diagnostiziert. Manche Mediziner behaupten sogar, man könne MCS nicht diagnostizieren, bzw. die Krankheit wäre nicht existent. Auch dass kein ICD-10 Code für MCS existent sei, wurde Patienten schon mitgeteilt, obwohl es kostenlose einfach zu handhabende Tools (z.B. ICD-10 Auskunft) gibt, mit denen sich jeder in Sekundenschnelle vom Gegenteil überzeugen kann. Andere weigern sich schlichtweg unter dem Vorwand, sie bekämen nur „Ärger“, wenn sie die Diagnose „MCS – Multiple Chemical Sensitivity“ stellen.
So schwer ist es nicht, MCS bei einem Patienten zu diagnostizieren:
Es gibt die American Consensus Diagnosekriterien, das validierte MCS Diagnosetool QEESI und ergänzend diverse umweltmedizinische Fragebögen.
Außerdem ist jeder Arzt verpflichtet, eine vernünftige Anamnese zu erstellen und dabei den Patienten gezielt zu befragen. Genau das halten erfahrene Ärzte und Kliniker für eines der allerwichtigsten Diagnoseinstrumente bei MCS, denn – was soll ein Patient sonst haben, wenn er über einen längeren Zeitraum heftige akute Symptome bspw. auf Autoabgase, Parfüm, Putzmittel, Pestiziden, Lacke, neue Teppichböden, Tageszeitungen etc. in geringster Konzentration entwickelt, die er vorher nicht hatte und wenn die Beschwerden verschwinden, wenn er sich in sauberer Umgebung befindet?
Oder, anders gefragt, warum sollte ein Patient lügen und falsche Angaben machen, um das Vorliegen einer MCS vorzugaukeln? Was hätte er davon? Nichts.
Provokationstests könnten den Beweis erbringen, doch mit welchem Risiko?
Theoretisch kann man das Vorliegen einer Chemikalien-Sensitivität mit Provokationstests beweisen. Dies ist jedoch schon aus rein ethischen Gesichtspunkten abzulehnen, weil das Risiko für den Patienten nicht vorherkalkulierbar ist. Außerdem ist der Aufwand, wirklich aussagekräftige Provokationests durchzuführen, immens. Der Patient muss dafür erst einmal für eine Weile in cleaner Umgebung sein, damit es zu keinen falsch negativen Ergebnissen kommt.
Warum? Ein veranschaulichendes Beispiel: Ein MCS-Patient, der in einer desinfizierten Klinikeinrichtung einem Provokationstest unterzogen wird, war zuvor zwangsläufig mit einer ganzen Palette von Chemikalien in Kontakt (z.B. Duftstoffe, Reinigungsmittel, etc.) Der ganze Aufenthalt in einem normalen Klinikgebäude ist, genau betrachtet, für MCS-Patienten mit einem einzigen fortlaufenden Provokoationstest gleichzusetzen. Daraus ergibt sich, dass ein Provokationstest unter solchen widrigen Bedingungen kein objektives Ergebnis liefern kann. Dazu braucht es eine Klinik mit optimalen umwelt- und schadstoffkontrollierten Gegebenheiten. In Deutschland gibt es aber keine Klinik, die diesen zwingend notwendigen Anforderungen entspricht.
Teure Labordiagnostik bei erster Diagnosestellung nicht erforderlich
Stapelweise teure Labordiagnostik braucht man zur Diagnosestellung von MCS nicht, weil bislang noch keine spezifischen MCS-Marker ermittelt wurden, die bei allen an MCS Erkrankten vorliegen. Das bedeutet nicht, dass MCS-Kranke keine pathologischen Befunde aufweisen. Es gibt genug wissenschaftliche Studien, die Auffälligkeiten belegen, aber d e n MCS-Marker, der bei allen nachzuweisen ist, hat noch keiner gefunden.
Für die Therapie ist weiterführende Diagnostik oft notwendig
Ist die Diagnose MCS erst einmal gestellt und es geht in Richtung Behandlung, dann wird es durchaus sinnvoll, dass verschiedene Laborparameter ermittelt werden, z.B. das Vorliegen von Chemikalien- und Schwermetallbelastungen, ob Defizite bestimmter Nährstoffe vorliegen, um diese mit Infusionen und oraler Gabe auszugleichen, Sauerstoffgehalt des Blutes vor einer Sauerstofftherapie, oder die Ermittlung von Gen-Polymorphismen, um eine Entgiftungstherapie auf die Entgiftungsfähigkeit des Patienten abzustimmen, Immunstatus, etc.
Genauso wie es sinnvoll ist, das ein PET und/oder ein SPECT Scan anberaumt wird, wenn der Verdacht besteht, dass Chemikalien eine toxische Schädigung des Gehirns verursacht haben.
Korrekte Diagnosestellung führt zu Qualitätssicherung bei der Behandlung
Ärzte sollten mehr Mut entwickeln, MCS zu diagnostizieren und mit ICD-10 T78.4 korrekt zu codieren, damit ebnen sie auch den Weg, dass adäquate, MCS-gerechte Kliniken geschaffen werden. Ohne existierende Kranke gibt es keine spezifische Behandlung, die von Krankenkassen übernommen wird und keinen Bedarf für Fachkliniken. Logisch, oder?
Fehldiagnosen gehen zu Lasten der Patienten
Deshalb muss, wenn MCS vorliegt, dies auch korrekt bezeichnet und mit ICD-10 T78.4 codiert werden und darf nicht mit irgendwelchen Pseudobegriffen umschrieben werden. Es geht auch nicht an, dass Multiple Chemical Sensitivity aus Abrechnungsgründen einfach anders bezeichnet wird, um höher abrechnen zu können. Das ist auch unter dem vorgeschriebenen QM (Qualitätsmanagement) so definiert, dem jeder Arzt verpflichtet ist. Genauso wie jeder Arzt vom geltenden Sozialgesetz her verpflichtet ist, eine Krankheit richtig zu kodieren.
Fehldiagnosen (z.B. MCS als psychische Erkrankung zu deklarieren, weil das u.U. mehr Geld beim Abrechnen bringt) gehen immer zu Lasten des Patienten, weil ihm auf diese Weise weiterführende Diagnostik verwehrt wird und er folglich auch nicht die richtige Behandlung erhält, die seinen Gesundheitszustand stabilisiert. Denn nur mit richtiger Diagnose kann auch eine Behandlung erfolgen, die der Krankheit angemessen ist. Ohne diese ist eine Verschlimmerung vorprogrammiert.
Autor: Silvia K. Müller, CSN – Chemical Sensitivity Network, 21. März 2010
Weitere CSN Artikel zum Thema: