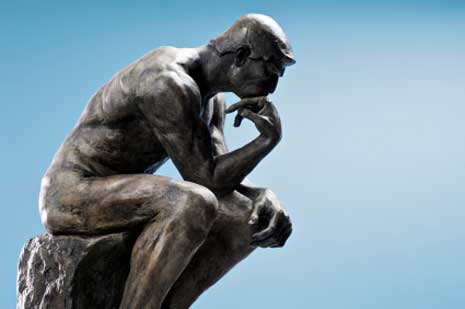CSN nimmt Duft-Briefmarken unter die Lupe
Am 7. Januar übergab Finanzminister Schäuble die neuen Wohlfahrtsbriefmarken an Bundespräsidenten Horst Köhler und an Frau Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg, Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. Das Besondere an den Briefmarken für dieses Jahr: Sie duften nach Obst: Heidelbeere, Erdbeere, Zitrone und Apfel. Die Duftstoffe wurden mikroverkapselt und sollen laut Beschreibung erst durch Reibung freigesetzt werden.
Die duftenden Briefmarken riechen auch ohne Reiben
CSN wollte wissen, ob die Briefmarken tatsächlich erst beim Darüberreiben duften und ließ die Duft-Marken besorgen. Auf die Bitte, die neuen Wohlfahrtsmarken kaufen zu wollen, zog die Dame am Postschalter einen Extra-Ordner hervor und bemerkte fast ehrfürchtig: „Oh ja, das sind die neuen duftenden Briefmarken“. Sie nahm einen Bogen mit Briefmarken hervor, die Heidelbeeren abbildeten, und vermeldete erfreut: „Das kann man ja wirklich riechen, auch ohne reiben.“
Es wurden zwei Wohlfahrtsmarken von CSN erworben und unter die Lupe genommen. Beide Briefmarken riechen auch ohne dass man mit dem Finger darüber reibt. Die Erdbeer-Briefmarke verströmt genau genommen einen Geruch wie eine billige Zahncreme mit Erdbeergeschmack und der Geruch der Zitronen-Briefmarken erinnert an Toilettenreiniger mit künstlichem Zitronenduft. Von natürlichem Obstgeruch keine Spur. Insbesondere der Zitronenduft intensivierte sich schon beim kurzfristigen Liegenlassen der Briefmarke bei Raumtemperatur. CSN verzichtete darauf den Geruch durch Rubbeln richtig zu aktivieren. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Duft der Marken durch unvermeidbares Aneinanderreiben von Briefen auf dem Postweg und beim Durchlaufen der Sortieranlagen in den Postzentren intensiviert. Daher ist es durchaus möglich, dass die Duft-Briefmarken auch andere Post kontaminieren.
Falls die verwendeten Duftstoffe auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden, würde es der so oft beschworenen Transparenz dienen, wenn bekannt wäre, nach welchen Kriterien von gesundheitlicher Unbedenklichkeit und mit welchen Methoden getestet wurde. Wurde ein gesunder Durchschnittsbürger oder ein Embryo als Modell zugrunde gelegt? Hat man die Duftstoffe an sich, oder die mit ihnen ausgerüstete Druckfarbe getestet? Hat das Material der Briefmarke einen Einfluss auf die Verträglichkeit? Die Infos der Bundesdruckerei legen nahe, dass bereits beim Drucken erste Spuren der Duftstoffe freigesetzt werden.
Duftstoffallergiker, Chemikaliensensible und Personen, die empfindlich auf Duftstoffe reagieren, kann dieser Werbegag gesundheitlich beeinträchtigen.
Als Resonanz schrieb CSN am 11. Januar den nachfolgenden Offenen Brief:
Offener Brief (vorab per E-Mail)
Duft-Briefmarken schränken Behinderte ein
Sehr geehrter Herr Bundespräsident Dr.Horst Köhler,
sehr geehrte Frau Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg,
sehr geehrter Herr Dr. Wolfgang Schäuble,
Sie haben am 7. Januar im Berliner Schloß Bellevue gemeinsam die neuen vom Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen Wohlfahrtsmarken vorgestellt, welche beim Reiben Duftstoffe mit Apfel-, Erdbeer-, Heidelbeer- oder Zitronenaroma freisetzen. Wir möchten Sie dazu auffordern, diese auf den ersten Blick sympathische Idee noch einmal zu überdenken und bitten Sie, Herr Dr. Schäuble, als Bundesfinanzminister höflichst, diese Postwertzeichen wieder aus dem Verkehr zu ziehen, da sie für Personengruppen mit bestimmten Behinderungen und Gesundheitsbeschwerden eine unterschätzte und nicht akzeptable Gefahr darstellen.
Wäre es nicht makaber, wenn einem Teil jener Menschen, denen mit diesen Wohlfahrtsmarken geholfen werden soll, durch deren in Umlauf bringen gesundheitliches Leid zugefügt würde? Ist Ihnen die kritische Haltung des Umweltbundesamtes zu Duftstoffen nicht bekannt? Das UBA weist seit Jahren darauf hin, dass Duftstoffe im öffentlichen Bereich vermieden werden sollten. Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) geht davon aus, dass (nach Meggs et al. 1996) rund 11 Prozent der Bevölkerung, das wären heute gut 9 Millionen Menschen, von einer olfaktorischen Hypersensitivität gegenüber Duftstoffen betroffen sind und fordert Warnschilder für beduftete Räume.
Kann man bei Menschen, die auf Duftstoffe mit gesundheitlichen Beschwerden reagieren, von einer Behinderung sprechen?
Nach dem Americans with Disabilities Act (ADA) gilt eine Person als behindert, die durch eine körperliche oder seelische Behinderung in einer oder mehreren Lebensaktivitäten substantiell eingeschränkt ist, die eine Krankengeschichte oder einen Befund zu einer solchen Behinderung besitzt oder die von anderen als derartig behindert wahrgenommen wird.
Das von der Bundesregierung am 30. März 2007 unterzeichnete Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-Behindertenkonvention) definiert behinderte Menschen als Personen, die unter langfristigen, körperlichen, seelischen, geistigen oder sensorischen Einschränkungen leiden, welche sie aufgrund diverser Barrieren an einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hindern können.
Parfümierte Postwertzeichen schränken Allergiker, Asthmatiker, Chemikalienkranke und andere empfindliche Menschen in ihrer Lebensführung auf unzumutbare Weise ein, was gegen die UN-Behindertenkonvention verstößt und auch dem im ADA formulierten Schutz behinderter Menschen nicht gerecht wird. Sehr empfindliche Kranke und solche, die unter Kontaktallergien auf Duftstoffe leiden, brauchen die Spuren dieser Stoffe nicht einmal zu riechen und werden nichts ahnend den ihnen verbliebenen, meist in prekärer finanzieller Situation schadstofffrei hergerichteten Lebensraum verseuchen.
Bisher konnten Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen durch Duftstoffe wenigstens ihre Postsendungen ohne fremde Hilfe in Empfang nehmen und öffnen. Diese Autonomie und Lebensnormalität wird ihnen genommen. Wer mit körperlichen Reaktionen rechnen muss, wenn er mit Duftstoffen in Kontakt kommt, wird selber keine Postsendungen mehr in Empfang nehmen können und auf andere Menschen angewiesen sein, die ihm diese ‚Briefbomben‘ aussortieren. Möglicherweise geht eine komplette Zustellung verloren, weil ein einziger Brief mit einem parfümierten Postwertzeichen alle andere Post kontaminiert hat.
Zu Weihnachten 2004 gab es eine ähnliche Aktion mit Duftaufklebern zum Rubbeln. Anders als damals von einem Mitarbeiter der Deutschen Post AG behauptet, sind die Duftstoffe nicht unter sicherem Verschluss. Niemand kann sich sicher sein, dass nicht schon auf dem Versandweg jemand an den Briefmarken rubbelt oder dass diese Substanzen aufgrund mechanischer Einwirkungen freigesetzt werden. Postsendungen kamen damals von selber duftend an und werden dies heute wieder tun.
Durch solche Sendungen können u.U. Menschen, die bisher an keiner Allergie gelitten haben, sensibilisiert werden. Wurden die verwendeten Duftstoffe ausreichend daraufhin getestet? Würden Sie für deren Unbedenklichkeit ihre Hand ins Feuer legen? Ist Ihnen bekannt, dass die wenigsten in Deutschland verwendeten Duftstoffe auf ihre Verträglichkeit geprüft sind. Nach dem „Spezialbericht Allergien, 2000“ des Bundes sind etwa 15 bis 25 Prozent der Bevölkerung von atopischen Krankheiten betroffen und ein Drittel ist allergisch sensibilisiert. Sollte nicht alles getan werden, diese Zahlen nicht weiter ansteigen zu lassen?
Duftstoffe lösen bei Menschen mit entsprechender Sensitivität eine Vielzahl von körperlichen Reaktionen aus. Je nach Erkrankung und Gesundheitszustand reichen diese von harmlosen Irritationen bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen. Folgende Beschwerden können einzeln oder in Kombination auftreten:
Müdigkeit, Niesen, Augenbrennen, gerötete Haut, Juckreiz, Bläschen, Entzündungen, Anschwellen und Brennen der Lippen, Brennen der Nasenschleimhäute, Brennen auf der Zunge, Zahnschmerzen, Husten, Stimmversagen, Atemnot, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, Migräne, Sprachstörungen, Gedächtnisstörungen, anhaltendes schmerzhaftes Übergeben, Herzschmerzen, Herzrasen, Schockzustand, Bewusstlosigkeit, Koma.
Häufig erhöht ein Vorfall mit Duftstoffen die Sensibilität für andere Substanzen oder macht eine über einen längeren Zeitraum durch Vermeidungsstrategien und gesunde Lebensweise mühselig erreichte Verbesserung des Gesundheitszustandes zunichte.
Nicht zuletzt können künstliche Düfte auch gesunde Menschen in ihrem ästhetischen Empfinden belästigen und erreichen nie die Sinnlichkeit ihrer Vorbilder. Legen Sie ein paar Äpfel vom Biobauer in Ihr Schlafzimmer und vergleichen sie das mit dem Duft dieser Briefmarken.
In Anbetracht all dessen fordern wir von Ihnen, dass die zu erwartenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen des auf Duftstoffe sensibilisierten Anteils der Bevölkerung zur Kenntnis genommen wird und das in Umlauf bringen der Duft-Briefmarken gemäß des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderung umgehend gestoppt wird.
Mit freundlichen Grüßen
Silvia K. Müller Bruno Zacke
CSN – Chemical Sensitivity Network