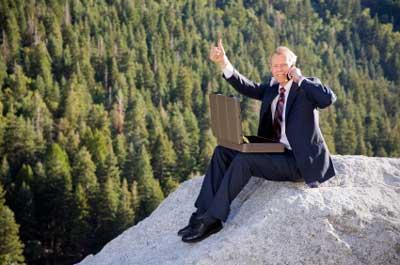Während eines Kongresses für Umweltmedizin vor ein paar Jahren erklärte ein Professor den anwesenden Umweltkranken, warum es so wichtig ist, sich mit den Hintergründen von chemikalieninduzierten Krankheiten auseinander zu setzen. Von den Zuhörern hatten sich einige beschwert, dass sein Vortrag von zu hohem Niveau für sie sei. Der Professor entgegnete, dass es unglaublich schwer sei, Recht zu bekommen, wenn man durch Chemikalien erkrankt sei, und dass es kaum Ärzte gäbe, die sich mit den schadstoffinduzierten Krankheiten wie MCS auskennen würde. Wenn ein Erkrankter gesünder werden und Recht bekommen wolle, müsse er sich mit der Materie auseinandersetzen, Fachbegriffe lernen und so zu einem kleinen Experten werden. Nur dann hätte man eine Chance. Wie recht er hatte.
Sternentänzer hat begriffen, dass der Professor absolut recht hatte. Sie ist eine von den Erkrankten, die zum stetig größer werdenden Kreis derer gehören, die nicht aufgeben, und immer am nachforschen sind, um Antworten zu finden. Heute hat Sternentänzer eine wertvolle Ausführung zu einer Pall/Anderson Studie für uns, damit wir MCS, deren Ursachen und die damit verbundenen Symptome besser verstehen. Der Artikel ist fachlich nicht einfach, aber er enthält wichtige Fakten für Euch. Also denkt an den Professor und beißt Euch durch, um ebenfalls zu einem kleinen Experten zu werden.
Lest, was Sternentänzer Euch zu sagen hat:
Die Substanzen, die im nachfolgenden Blogartikel aufgeführt werden, beruhen auf dem Artikel von Pall und Andersen von 2004. Sie sind in der Lage, die Vanilloidrezeptorgruppe zu aktivieren.
Ich habe diese Tabelle für mich selber gemacht. Da ich kein Chemiker bin, habe ich mir z.B. bei Alkylbenzole aufgeschrieben, dass es sich um ein Molekül mit einem Benzolring und einer Kette C2H5 handelt. Ich kann mir dann das Molekül so etwas besser vorstellen. Wenn es Euch nicht interessiert, dann überspringt es ruhig.
Da im Artikel von Pall und Anderson hauptsächlich allgemeine Gruppen angegeben wurden, habe ich zu ihnen einige Beispiele rausgesucht und sie mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Einige Faustregeln im Hinblick auf die TRP Rezeptoren:
TRPV1: Alles was scharf ist wie Pfeffer, Ingwer, Vanillin (auch altes Papier)
TRPA1: Alles was scharf ist wir Zwiebeln, Knoblauch, Meerrettich, Kohl,…
TRPV3: ätherische Öle in vielen Kräutern wie Thymian, Majoran, Kümmel, Sellerie, Rosmarin
Agonisten von TRP Rezeptoren und wo sie vorkommen bzw. in welchen Bereichen sie verwendet werden
Alkylbenzole (Ring+C2H5)
Gruppenbezeichnung für am Benzol-Ring durch Alkyl-Gruppen substituierte aromatische Kohlenwasserstoffe. Zu diesen Alkylaromaten (vgl. Alkylaryl…) gehören die in Einzelstichwörtern behandelten Toluol u. die Xylole (diese Alkylbenzole werden oft mit Benzol zusammengefasst unter der Abk. BTX), Ethylbenzol, Mesitylen, Durol, Cumol, Cymol u.a., die als Produkte der Alkylierung von Benzol, heute bevorzugt aus Kohle oder Erdöl, durch thermische oder katalytische Prozesse mit anschließender Isolierung gewonnen werden (s. Petrochemie). Alkylbenzole lassen sich am Kern oder in der Seitenkette substituieren (s. Substitution). Die wichtigsten Oxidationsprodukte der Alkylbenzole sind Carbonsäuren bzw. Phenol.
Benzol
Verw.: Als Beimischung zu Motorkraftstoffen, als Ausgangsmaterial für die Herstellung vieler B.-Derivate (z.B. Anilin, Nitrobenzol, Styrol, Nylon, Synthesekautschuk, Kunststoffe, waschaktive Stoffe, Phenol, Insektizide, Farbstoffe u.v.a.), als Lösungsmittel für Kautschuklacke, Wachse, Harze, Öle, u. als Extraktionsmittel.
Toluol – Methylbenzol
Toluol wird unter anderem durch Kfz-Verkehr freigesetzt, weil es im Benzin enthalten ist, und entsteht in kleinen Mengen bei der unvollständigen Verbrennung von organischen Stoffen, wie zum Beispiel beim Rauchen
Xylol – Dimethylbenzol
Xylol wird hauptsächlich als Lösungsmittel verwendet. Es dient zur Herstellung von Kunststoffen, Farben und Klebstoffen. Es wird Kraftstoffen zur Erhöhung der Oktanzahl beigemengt.
– Ethylbenzol*
Verw.: E. wird fast ausschließlich zur Herstellung von Styrol verwendet, nur ein kleiner Teil des Ethylbenzols wird als Lösungsmittel eingesetzt oder dient als Zwischenprodukt, z.B. zur Herst. von Diethylbenzol oder Acetophenon.
– Mesitylen-Trimethylbenzol *
Mesitylen wird als Lösungsmittel für Harze und Gummi sowie zur organischen Synthese (zum Beispiel von Antioxidantien) verwendet. Es kommt in Petroleum und Steinkohlenteer vor.
– Durol – Tetramethylbenzole *
dient zur Herstellung wärmebeständiger Alkydharze, Polyester, Polyamide und Polyimide, Weichmachern, Kunstharzen usw.
– Cumol -2-Phenylpropan, Isopropylbenzol *
Verw.: C. dient überwiegend zur Herstellung von Phenol, C.-haltige Alkylierungsprodukte des Benzols werden zur Octanzahl-Verbesserung für Vergaserkraftstoffe eingesetzt. Sulfonierung führt zum Cumolsulfonat, das als Hydrotropikum (Tenside) Verwendung findet.
– Cymol – 1-Methyl-4-isopropylbenzol *
Die physiologische Wirkung ähnelt der des Toluols (LD50 Ratte p.o. 4,7 g/kg). p-C. kommt in etherischen Ölen (Kümmelöl, Eukalyptusöl u.s.w.) vor und ist mit vielen natürlich vorkommenden Terpenen strukturverwandt (p-Menthan).
Verw.: als Lösungsmittel, Duftstoff in Kosmetika, zur Synthese von Carvacrol, Thymol usw.
Ether
R1-O-R2 H3C-O-CH3 Dimethylether
Vork.: Methylether sind in der Natur weit verbreitet, als Phenolether in den Glykosiden, vor allem bei Alkaloiden, Blütenfarbstoffen, Geruchsstoffen (Vanillin); Ether-Bindungen liegen in den Zuckern und Polysacchariden (Cellulose, Stärke) vor.
Verw.: Wegen ihrer außerordentlichen Lsg.-Eig. finden Ether als Lösemittel und Extraktionsmittel, die Glykolether auch als Weichmacher in der Industrie.
Verw.: Einige Ether werden als Narkosemittel, andere als Aerosol-Treibgase eingesetzt. Technisch wichtige Ether sind u.a. Diethylether, Diisopropylether, Tetrahydrofuran, Dioxan, Anisol, Diphenylether.
Chloracetophenone und o-Chlorobenzylidene malononitrile
Tränengas
Cyclohexanone
Verw.: Lösungsmittel für viele Lackrohstoffe, Polyvinylchlorid und bas. Farbstoffe, in Form von Ketonharzen (Cyclohexanonharze), zur Verbesserung von Verlauf und Glanz von Lacken und als Zusatz für Lederdeckfarben, Spezialdruckfarben und Abbeizmittel.
Alkohole
Ethanol („normaler“ Alkohol)
Propanol Desinfektionsmittel, Lösungsmittel
Methylanthranilate
Anthranilate – Bezeichnung für Salze u. Ester der o-Aminobenzoesäure.
Verw.: Als Ausgangsstoff für die Synthese von Azofarbstoffen, Folsäure, Sonnenschutzmitteln, Lokalanästhetika und Riechstoffen.
Aldehyde
Aldehyde sind durch die Aldehyd-Gruppe-C (=O) H charakterisiert. Ihre Benennung erfolgt
1. durch Trivialnamen (z.B. Vanillin, Acrolein)
2. ersetzt man bei den lateinischen Namen der Säuren, die bei der Oxidation der betreffenden Aldehyde entstehen, die Endung durch -aldehyd, so z.B. Formaldehyd. Die Aldehyde sind sehr reaktionsfähige Verbindungen.
Anw.: Die niederen Aldehyde als Rohstoffe für die Synthese von Kunststoffe und Kunstharze (Aminoplaste, Phenoplaste), als Desinfektionsmittel, zum Gerben etc., die höheren Aldehyde zur Herstellung von Riechstoffen (Aldehyd-Noten in Parfüms). Aromatische Aldehyde werden zu Aromen, Pharmazeutika, Pflanzenschutzmitteln und Farbstoffen verarbeitet.
– Acetaldehyd*
Hauptsächlich dient Acetaldehyd als Zwischenprodukt in der chemischen Industrie. So wird er als Bestandteil von Farben, zur Herstellung von Parfümen und Färbemitteln, in der Gummi-, Papier- und Gerbindustrie, als Konservierungsstoff von Früchten und Fisch, als Geschmacksstoff, zur Gelatinehärtung und als Treibstoffbeimischung eingesetzt. Acetaldehyd dient auch zur Herstellung von Essigsäure sowie Pentaerythrit.
– Glutaraldehyd *
OHC-CH2-CH2-CH2-CHO
Glutaraldehyd wirkt bakterizid und dient daher zur Konservierung und Desinfektion von Geräten und Instrumenten in der kosmetischen Industrie als Härter für Gelatine, da es mit Proteinen durch Quervernetzung reagiert. Als Gerbmittel gibt Glutaraldehyd weiche, widerstandsfähige Leder. Es wird als Hydrophobierungsmittel (wasserabweisend) für Papier, Tapeten, Textilien und dgl. eingesetzt.
– Zimtaldehyd (Cinnamaldehyd, 3-Phenyl-2-propenal) *
H5C-CH=CH-CHO
Verw.: Zur Parfümierung von Seifen, zu Gewürzen, Aromen, zur Herstellung des Zimtalkohols usw.
– Benzaldehyd *
(künstliches Bittermandelöl). H5C6-CHO
Verw.: Als chemische Reagenz, Lösemittel zur Herstellung von Triphenylmethan-Farbstoffen, Zimtsäure, Pharmazeutika u. Parfümen, Marzipan
Pflaumen und Pfirsiche.
– Glyoxal *(Dialdehyd)
C2H2O2
Glyoxal dient als Rohstoff für Synthesen und wird auch in der Textilveredlung sowie als Komponente in Desinfektionsmitteln eingesetzt.
Formaldehyd
bildet sich spurenweise auch bei der unvollständigen Verbrennung von Holz, Kohle, Zucker usw.
Desinfizieren und Sterilisieren, zur Konservierung, z.B. in kosmetischen Präparaten (hier jedoch nur mit Einschränkungen zugelassen), zum Beizen des Saatgutes, Vulkanisationsbeschleunigern, zum Aufbau künstlicher Gerbstoffe, als Faserschutzmittel für Wolle, in der Textilveredlung zur Permanent-Press-Ausrüstung von Rayon und Zellwolle, zum Stabilisieren von Grundierungsbädern in der Naphthol-Färberei, in einigen Kunstharzen.
Kommt natürlich in Äpfeln und Weintrauben vor.
Entsteht bei allen unvollständigen Verbrennungen, Flächendesinfektionsmittel, Duroplast, Bakelit.
Säuren (niedrieger ph Wert)
– Essigsäure (H3C-COOH)
– Propansäure (H3C-CH2-COOH)
Schwefeldioxid SO2
In der Lebensmittelindustrie findet SO2 unter der Bezeichnung E 220 als Konservierungsmittel und Antioxidationsmittel Verwendung, vor allem für Trockenfrüchte, Kartoffelgerichte, Fruchtsäfte, Marmelade und Wein. SO2 dient auch zur Herstellung von vielen Chemikalien, Medikamenten und Farbstoffen und zum Bleichen von Papier und Textilien.
Toluoldiisocyanat
In der chemischen Industrie ist TDI ein wichtiges Zwischenprodukt für die Herstellung von Klebstoffen, Schaumstoffen (Polyurethane), Elastomeren, Beschichtungen und hochwertigen Lacken zur Verwendung in der Automobilindustrie, für Flugzeug- oder Triebwagenlackierungen.
Chlor
Verw.: Chlor ist eines der wichtigsten Grundprodukt der chem. Industrie. Der größte Teil der Produktion wird zur Herst. von Vinylchlorid u. PVC verwendet (in der BRD etwa 25%), sowie von anderen organischen Chlor-Verbindungen (Chloroform, Methylenchlorid, Tetrachlormethan, Chloropren, Chloraromaten usw.) und Zwischenprodukten (Phenol, Ethylenglykol, Propylenoxid, Glycerin u.a.). Weiterhin werden Cl2 und aktives Cl enthaltende Verbindungen zum Bleichen von Papier u. Cellulose, sowie zur Desinfizierung von Trinkwasser u. Freibädern eingesetzt.
Alkane (Methan, Ethan, Propan)
Vork: Erdöl. Erdgas, Kohle
Verw.: (s. Abb.) Als Lösemittelgemische., Brennstoffe, Treibstoffe, zur Fettsynthese, zur Überführung in Olefine, die als Ausgangsstoffe für Alkylbenzole eine große Rolle für die synth. biologisch abbaubarer Waschmittel spielen, zur Gewinnung von Fettsäuren durch Luftoxidation.
Halogenierte Benzole
– Chloraromaten
Sammelbezeichnung für verschiedene kernchlorierte aromatische Verbindungen wie z.B. die (im allg. in Einzelstichwörtern behandelten) Chlorbenzole (Mono-, Di-, Tri- etc. Chlorbenzol), Chlornaphthaline, Chlortoluole, Chlorbiphenyle (s.a. PCB) u.a. aromatische Chlorkohlenwasserstoffe (CKW); auch Chlorphenole und Derivate wie 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo[1,4] dioxin können hierher gerechnet werden. Die Chloraromaten finden vielfache Verwendung, z.B. als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln, Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmitteln, Desinfektionsmitteln, Konservierungsstoffen, Farbstoffen usw.
– Chlorbenzol*
Verw.: Lösungsmittel für Öle, Fette, Harze, Kautschuk, Ethylcellulose, Wärmeübertragungsmittel, Zwischenprodukt bei der Herstellung von Insektiziden, Farbstoffen, Arzneimitteln, Duftstoffen, Phenol usw.
Ketone
Von Aceton abgeleiteter Gruppenname für Verb. der allg. Formel R1R2C=O, wobei die org. Reste Alkyl- u./od. Aryl-Gruppen darstellen bzw. zum Ring geschlossen sein können.
Vork.: In der Natur sind Ketone sehr verbreitet, z.B. in Form von Sexualhormonen u.a. Steroidketonen, als Terpenketone in ätherische Ölen und Duftstoffen.
Ketone finden auch Verwendung als Ausgangsstoffe für synthetische Produkte in der pharmazeutische Farbstoff-, Riechstoff-, Schädlingsbekämpfungs- und Kunststoff-Industrie (s. Ketonharze).
Autor: Sternentänzer für CSN – Chemical Sensitivity Network, 10. 12.2007
Literatur:
1. Pall ML, Anderson JH (2004): The Vanilloid Receptor as a Putative Target of Diverse Chemicals in Multiple Chemical Sensitivity. Archives of Environmental Health July 2004 [Vol. 59 (No. 7)]
2. CD Römpp Chemie Lexikon, Version 1.0, Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag 1995
3. CD Wikipedia deutsch 2007