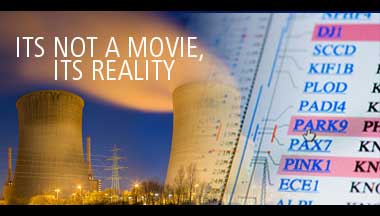Umweltambulanz einer Krankenkasse findet Schadstoffe als Ursache von Krankheiten
Umweltkrankheiten sind auf dem Vormarsch. Eine deutsche Krankenkasse hat dies erkannt und zum Wohle ihrer Mitglieder eine Umweltambulanz gegründet, die nach den Ursachen von Atemwegserkrankungen, Müdigkeit, Augenreizungen, Kopfschmerzen und Anfälligkeit für Infektionen sucht und tatkräftig Hilfe anbietet. Ganz das Gegenteil vieler universitärer Umwelt-ambulanzen, die sich offensichtlich darauf verlegt haben, die Existenz von Umweltkrankheiten in Abrede zu stellen oder vehement der Psyche zuzuordnen.
Ursache bekannt: Wohngifte, Schadstoffe
„Atemwegserkrankungen, Müdigkeit, Augenreizungen, Kopfschmerzen, Allergien und Anfälligkeit für Infektionen. Diese Erkrankungen haben alle etwas gemeinsam: Sie alle sind die häufigsten Beschwerden, die durch Wohngifte und Schimmelpilze entstehen.“ So steht es in der Beschreibung der Umweltambulanz der IKK Niedersachsen zu lesen. (1)
Helfen und sparen, statt Patienten im Regen stehen zu lassen
Aussagen von Umweltkranken und Statistiken nach zu urteilen ist es schwer, überhaupt einen Arzt zu finden, der Beschwerden dem Kontakt mit Umweltschadstoffen zuordnen kann. Für Krankenkassen kann dies teuer werden, denn zwangläufig geht der Patient auf der Suche nach Hilfe von Arzt zu Arzt. Viele Beschwerden chronifizieren, weil die Ärzte zwar alle Möglichkeiten der Diagnostik ausnutzen, aber dennoch zu keinem konkret verwertbaren Ergebnis kommen, um den Patienten zu helfen. Es fehlt an spezifischem Fachwissen zum Erkennen umweltbedingter und schadstoff-induzierter Erkrankungen. Mancher Patient kann daher eine Odyssee von über 50 Ärzten und Kliniken aufweisen.
Eine Umweltambulanz geht Ursachen auf den Grund
Früher führte ein Hausarzt noch Hausbesuche durch und kannte dadurch das Lebensumfeld seiner Patienten. Dieser häusliche Kontakt ist heutzutage nicht mehr möglich, und ein Arzt kann in seiner Praxis zwar den Verdacht erheben, dass eine Erkrankung vom Wohnraum herrühren kann, aber dann sind ihm die Hände weitgehend gebunden. Die IKK Umweltambulanz Niedersachsen schreibt dazu: „Ohne genaue Kenntnis der Wohnbedingungen der Patienten kann der Arzt keine weiteren Rückschlüsse ziehen, denn die labormedizinischen Untersuchungen allein bringen nicht die gewünschte Klärung.“
Die Krankenkasse bietet an, dass in einem solchen Fall die Ärzte ihre Patienten an die Umweltambulanz verweisen können. Die Umweltambulanz übernimmt dann die Aufgabe, den häuslichen Bereich der Patienten umfassend zu untersuchen.
Die Aussagen einer der Experten der IKK Umweltambulanz machen Sinn:
„Nach Betrachtung der gesundheitlichen Probleme der Betroffenen inspizieren wir bei einer Wohnungsbegehung alle Räume vom Keller bis zum Dachstuhl. Wir ermitteln mögliche Quellen für Schadstoffe oder Feuchtigkeit durch orientierende Messungen, durch Materialproben oder Probennahmen der Raumluft“, erklärt Diplom-Chemieingenieur Christian Tegeder von der Umweltambulanz der IKK Niedersachsen.
Schadstoffquellen, die Krankheiten auslösen können, gibt es tatsächlich in vielen Wohnungen, wie an einem der von der IKK beschriebenen Beispiele, dem Formaldehyd, deutlich wird:
„Formaldehyd ist ein sehr bekannter Schadstoff. Er gast insbesondere aus Spanplatten aus, die in Möbeln, Paneelen, Fußböden oder Trennwänden verwendet werden. Hohe Ausdünstungen von Formaldehyd können zu Schleimhautreizungen, Kopfschmerzen, chronischen Erkältungen und Allergien führen.“
Schimmel – kein Problem
Ein weiteres rasant wachsendes Innenraumproblem durch abgedichtete Häuser ist Schimmel. Die Umweltambulanz verfügt daher sogar über einen eigenen schwedischen Spürhund, der speziell für die Suche nach versteckten Schimmelpilzen und Bakterien ausgebildet wurde. Die Proben werden anschließend im eigenen Labor untersucht. Ist das Ergebnis positiv, wird der Patient nicht mit einem Laborbogen alleine gelassen, sondern bekommt konkrete Sanierungsvorschläge. Die IKK Niedersachsen ist vorbildhaft, denn sie übernimmt sogar die Kosten für Anfahrt, Beratung und Begehung vollständig. Bei den Kosten für Messungen und Berichte beteiligt sich die IKK Niedersachsen an 80 % der Kosten, maximal bis zu 400 €.
Enorme Erfolgsquote
Das Konzept scheint offensichtlich komplett aufzugehen. Die IKK Umweltambulanz berichtet, dass, wenn Patienten von Ärzten an die Umweltambulanz verwiesen wurden, diese in den meisten Fällen auch Schadstoffe findet, die als Ursache für die Erkrankung in Frage kommen.
Eine Auswertung der Ärzte-Zeitung habe ergeben, dass Ärzte oftmals wirklich goldrichtig liegen, wenn sie auf die IKK Umweltambulanz verweisen:
Hautärzte lagen in 74 % der Fälle richtig, wenn sie eine Umweltbelastung als Ursache einer Hautkrankheit vermuteten, Lungenärzte lagen sogar in 88 % der Fälle richtig. Am häufigsten verweisen im übrigen Allgemeinmediziner ihre Patienten auf die Umweltambulanz, gefolgt von Kinderärzten, Internisten, Haut- und Lungenärzten. (1)
Qualitätsunterschiede bei Umweltambulanzen
Während die IKK Umweltambulanz Niedersachen durch ihre gezielte Vorgehensweise, inkl. Hausbegehungen, bei über einem Dreiviertel der Umweltpatienten fündig wird und dadurch die Situation für den Patienten verbessern kann, gibt es in anderen Umweltambulanzen gegenteilige Denkansätze und Vorgehensweisen.
In einer Veröffentlichung einiger universitärer Umweltambulanzen im Deutschen Ärzteblatt stand zwar zu lesen, dass neben der Anamnese, klinischen Untersuchung und Differenzialdiagnose nach strenger Indikationsstellung Analysen von Körperflüssigkeiten, Ortsbegehungen und Umgebungsanalysen in die Bewertung mit einzubeziehen seien, doch in der Praxis kommt man zu völlig anderen Ergebnissen als in Niedersachsen. Nur bei bis zu 15 % der Patienten gelänge es, eine relevante Exposition zu identifizieren. In 40 bis 75 % der Fälle würden andere somatische und/oder psychische Erkrankungen ohne eine nachvollziehbare oder nachweisbare Exposition diagnostiziert werden. (2)
Die Autoren gaben im Ärzteblatt deutlich zu verstehen, dass es zur Indikationsstellung wichtig sei, die Grenzen umweltmedizinischer Diagnoseverfahren zu kennen. Nur so könne ihrer Meinung nach vermieden werden, dass Untersuchungen durchgeführt werden, aus deren Ergebnissen sich keine Konsequenzen ableiten lassen und die daher weder dem Arzt noch dem Patienten weiterhelfen würden. (2)
Klinischer Alltag an universitären Umweltambulanzen
Als Bedeutung für ihren klinischen Alltag und die Therapie der Patienten gaben die Autoren im Ärzteblatt an: „Die beklagten körperlichen Beschwerden lassen sich nicht oder nicht hinreichend durch eine organische Erkrankung erklären und eine Somatisierung ist in vielen Fällen das zentrale Problem. Die Frage nach der Ätiologie von Beschwerden kann mit dieser Diagnose für den Patienten meist nicht befriedigend beantwortet werden. Auf der Basis dieser Diagnose kann man ihm jedoch unter anderem psychotherapeutische Angebote machen.“ (2)
Konträre Diagnose- und Therapieangebote
Wie konträr die Einstellung dieser universitären Umweltambulanzen gegenüber dem Angebot der IKK Umweltambulanz ist, verdeutlicht auch die Aussage des Mitautors des angesprochenen Artikels im Deutschen Ärzteblatt. Der Leiter der Umweltambulanz Giessen, Prof. Dr. Thomas Eikmann, gab in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau folgenden Einblick in seine Auffassung hinsichtlich effektiver Diagnostik und Therapie von Umweltkranken. Sein Team versuche, den Patienten andere Erklärungsmuster zu geben, „um sie aus dem Teufelskreis herauszukriegen“. So sollen sie seiner Meinung nach versuchen, Gerüche auszuhalten, „ohne gleich umzufallen. Die müssen aus der sozialen Isolierung raus.“ (3)
Auch der Leiter des Robert Koch-Institut, Dr. Dieter Eis, hat Zweifel an der Diagnose „krank durch Schadstoffe“. In der Apotheken-umschau konnte der Leser seine Meinung vernehmen: „Da tummelt sich ein breites Spektrum von Anbietern.“
„Das reicht von wissenschaftlich basierter Arbeit bis hin zu paramedizinischen Methoden“. „Wenn man saubere Befunde haben will, ist das aufwendig und schwierig“, erläutert Eis. „Da werden viele Fehler gemacht und voreilige Schlüsse gezogen.“ (4)
Mit einer Aussage von Thomas Eikmann von der Umweltambulanz Giessen schloss den Artikel in der Apothekenumschau wie folgt ab: „Krankheiten haben viele Ursachen“, erklärt Thomas Eikmann. „Schadstoffe spielen dabei nur eine begrenzte Rolle“. Eine einfache Zeitreihe widerlege, dass Alltagschemie uns immer kränker mache: „Die durchschnittliche Lebenserwartung der Deutschen steigt seit Langem – und zwar stetig und ungebremst.“ (4)
Wesentlich innovativer und effektiver sieht da die Vorgehensweise der IKK Umweltambulanz aus: Dort hat die IKK Umweltambulanz Niedersachsen mit dem Verband des Tischlerhandwerks in Niedersachsen und Bremen gemeinsam mit weiteren Projektpartnern wie dem Beratungs- und Kompetenzzentrum „BWE Bauen Wohnen Energie“ und dem Malerverband Niedersachsen die Initiative „Gesundes Wohnen“ gestartet. Qualifizierte Fachbetriebe aus diesen Branchen beraten Patienten fachkundig zu allen Fragen rund um deren Wohnumfeld, um deren gesundheitliche Situation zu verbessern.
Auf die Frage, ob Schadstoffquellen wie bspw. Holzdecken oder verschimmelte Dämmstoffe sofort entfernt werden müssen, gab der Experte der IKK Umweltambulanz zur Antwort:
„Meistens ja. Belastete Paneele, schimmelige Wandverkleidung, Laminat oder Spanplatten müssen raus und ersetzt werden. Die Erfahrung zeigt: Wer seine Wohnräume auf Schadstoffe untersuchen lässt, hat oft schon seit Jahren gesundheitliche Probleme. Man sollte die Ursachen also klären lassen und dann zügig und vor allem fachgerecht beseitigen. Am besten von einem Betrieb, der sich als Fachbetrieb für gesundes Wohnen hat zertifizieren lassen.“ (1)
Schadstoffbedingte Krankheiten: Akzeptieren und Handeln spart Unsummen
Das Konzept der IKK, Schadstoffe als Ursache für Beschwerden der Patienten ernst zu nehmen, geht jedenfalls auf, wie die Erfolge bestätigen. Es sollte Schule machen, denn es hilft im beträchtlichen Maße, die leeren Taschen der Krankenkassen zu schonen. Nicht nur das, wie viel Gesundheit kann zurück gewonnen oder Chronifizierung von Krankheiten entgegengesteuert werden, wenn die richtige Diagnose zügig gestellt wird und darauf folgend bspw. eine sachgemäße Sanierung eingeleitet wird.
Eine Erhebung der staatlichen kanadischen Umweltklinik in Nova Scotia bestätigt die Richtigkeit und Effizienz solcher gezielten Herangehensweise, des Akzeptierens der Existenz von schadstoffbedingten Umweltkrankheiten und deren adäquater Behandlung:
Der gesamte jährliche Rückgang der Arztkonsultationen während der Jahre seit der ersten Konsultation der Umweltklinik in Fall River bis 2002 lag bei der Gruppe im Jahr 1998 bei 9,1%, bei der Gruppe von 1999 bei 8% und bei der Gruppe von 2000 bei 10,6%, verglichen mit 1,3% bei der Gesamtbevölkerung von Nova Scotia. Bei der Patientengruppe von 1998 lag die Reduzierung der Arztbesuche bei den Patienten mit den meisten Symptomen vor der Therapie sogar bei 31% in den Folgejahren nach der Behandlung in der Umweltklinik. (5)
Bleibt zu hoffen, dass das Konzept der IKK Umweltambulanz Nachahmer findet und ein gewaltiges Umdenken an so mancher universitären Umweltambulanz in Deutschland stattfindet.
Autor: Silvia K. Müller, CSN – Chemical Sensitivity Network, 29.12.2008
Anm:
Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und ist nicht als Werbung für die IKK Krankenkasse zu verstehen. Es bestehen keine Verbindungen oder Abhängigkeitsverhältnisse.
Literatur:
1. IKK Umweltambulanz, Umweltambulanz der IKK Niedersachsen, Stand www. Dez. 2008
2. Klinische Umweltmedizin, Clinical Environmental Medicine, Dtsch Arztebl 2008; 105(30): 523-10000, DOI: 10.3238/arztebl.2008.0523
3. Frauke Haß, Wenn Parfum zur Ohnmacht führt. Manche Menschen vertragen keine Chemikalien, Frankfurter Rundschau, 3.11.2007
4. Apothekenumschau, „Wie gesund ist unsere Umwelt?“, 15.07.2008
5. Silvia K. Müller, Adäquate Behandlung von MCS Patienten in einer Umweltklinik spart Gesundheitskosten, CSN Blog, 30.Sept. 2008