In Gedenken an Brigitte S.
Dieser Blog erscheint mit Absicht am Tag und zur Stunde der Trauerfeier. Er soll uns daran erinnern, dass das Leiden von Brigitte S. und ihr Tod nicht umsonst sein dürfen.

Es beginnt
Brigitte arbeitete seit ihrer Lehre als Zahntechnikerin. Dabei hatte sie Kontakt mit einer Reihe von Stäuben, Metallen, Desinfektionsmitteln, Kunststoffen, Klebern, Lösungsmitteln u.v.m. Sie hatte keine Ahnung von den Gefahren ihres Berufs, wusste nichts über die Auswirkungen auf ihren Körper. Sie beobachtete psychische Veränderungen an ihren Arbeitskollegen, viele waren cholerisch. Aber sie erkannte den Zusammenhang zwischen der Arbeitsumgebung, der Arbeitsbelastung und dem Verhalten ihrer Kollegen nicht als krankheitsauslösend. „Beruflicher Stress“ war die gängige Erklärung.
Bis Ende 2003 zwang Brigitte sich zum Durchhalten im Job, dann zeigte ihr Körper sehr deutlich seine Grenzen: Gewichtsabnahme, Schmerzen am ganzen Körper, Tinnitus, Übelkeit, Schlaf- und Sehstörungen, Müdigkeit, Gedächtnisabfall und Desorientierung. Die Symptome traten nicht alle gleichzeitig auf. Immer mal eines, dann ein anderes. Ihr Körper veränderte sich, das spürte sie ganz deutlich.
Wie jeder Kranke ging Brigitte von Arzt zu Arzt: Hausarzt, Augenarzt, HNO, Internist… Sie bekam Einzeldiagnosen auf die Symptome und Medikamente. Nur wirksame Hilfe bekam sie nicht. Sprüche hörte sie häufiger: „So viele Allergien wie Sie kann kein einzelner Mensch haben.“ Kein Arzt durchschaute die Zusammenhänge, untersuchte mögliche Ursachen, nichts. Interdisziplinäre Konsultationen – was ist das denn?
Die Psychiatrisierung
Anfang 2004 begann das, was MCS-Kranke nur zu gut kennen: Erst eine ambulante psycho-therapeutische Behandlung, dann ein mehrmonatiger Klinikaufenthalt.
Für Brigitte muss die Zeit in der Klinik schwer gewesen sein. Stationäre Aufnahme bedeutete für sie: Keine Außenkontakte zum Ehemann oder Verwandten, nur am Wochenende Besuch, Medikamentengabe bar jeder Verträglichkeitsprüfung, Umnebelung, Ruhigstellung,…Wer aufmuckte, oder sich beschwerte, wer seiner Verzweiflung über die sich nicht ändernde Krankheitssymptome zum Ausdruck brachte, wer den Druck nicht aushielt, der wurde auffällig und machte sich unbeliebt. Die Medikamentengabe führte zu einer Sedierung, die Umnebelung nahm zu, Bauchkrämpfe traten auf, und einen klaren Gedanken fassen konnte sie nur selten.
Der Klinikaufenthalt hat schlussendlich an den zahlreichen körperlichen Symptomen nichts geändert. Brigitte wurde mit der gleichen Diagnose entlassen, mit der sie ihren Aufenthalt begann. Behandlungsvorschlag für die Zeit danach: „…vor allem Antidepressivabehandlung unbedingt sinnvoll, aktuell keine Rehaindikation, derzeit auch noch keine erhebliche Minderung der Erwerbstätigkeit.“
Auf sie wirkten kurze Zeit später die Worte eines Gutachtens wie Hohn. Zitat:
„… Sie erlebte die Klinikzeit wie einen Neubeginn des Lebens, wo sie wünschen und wollen darf, statt nur zu funktionieren und zu gehorchen. Ihre körperlichen Schmerzen begannen, sich in seelische Schmerzen zu verwandeln….“
Kann das wahr sein? Schmerzen bleiben Schmerzen, egal welche Ursache sie haben! Brigitte wurde aus medizinischer Sicht auf Zeit als arbeitsunfähig eingestuft. Andererseits schloss man eine Erwerbsminderung aus. Verstehe das, wer will.
Die wahre Diagnose: MCS
Im September 2004 besuchte Brigitte einen Qi Gong-Kurs. Voller Hoffnung hatte sie daran teilnehmen wollen, um etwas Ablenkung von ihren Sorgen und Schmerzen zu bekommen, um ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Doch schon die Autofahrt dorthin, obwohl nicht sehr lang, machte ihr Schwierigkeiten. Im Laufe der Übungen traten vermehrt Schmerzen auf.
Durch eine andere Kursteilnehmerin mit MCS erfuhr Brigitte zum ersten Mal, dass ihre Krankheitssymptome auch ganz andere Ursachen haben könnten. Im Oktober 2004 besuchte sie zusammen mit ihrem Ehemann zum ersten Mal Dr. Binz in Trier. Im Februar 2005 lagen die kompletten Untersuchungsergebnisse vor:
„Schwere Neuropathie, schwere Myopathie, Ataxie, Hörminderung, Überempfindlichkeit gegenüber lauten Tönen, schwere Störung der Leistungen in der Psychometrie, schwere und vielfältige chemische Überempfindlichkeit, schwere Störung der Glukose-Utilisation im PET nach insgesamt 35 Jahren Arbeit als Zahntechnikerin.“ Mit anderen Worten: Brigittes Gehirn war auch noch schwer geschädigt. Und es war eine Erklärung für viele Beeinträchtigungen der Sinnesorgane.
Was dann?
Jetzt hatte Brigitte zwar eine exakte Diagnose, wusste, dass sie nie mehr arbeitsfähig sein würde und einen Rentenantrag stellen sollte – mehr aber nicht. Der Begriff „Expositionsvermeidung“ sagte ihr nicht viel. Noch schlimmer – sie bezog es auf die alte Arbeitsumgebung. Arbeiten konnte sie nicht mehr – also war alles gut. Auf die Idee, dass noch etwas anderes damit gemeint sein könnte, kam sie nicht. Die „Überprüfung der Lebensbereiche nach möglichen weiteren Auslösern“ ging in anderen, für sie wichtigeren Aktivitäten unter. Es gab und gibt keine Schulung, die Menschen mit dieser Diagnose auf ihre neuen Lebensumstände vorbereitet. Keine Stelle erklärte die Zusammenhänge, die notwendigen Veränderungen in der Lebensführung, und all das Notwendige zur Verbesserung der eigenen Situation.
Das Pragmatische – der Rentenantrag – wurde gestellt und führte zu neuen, seelischen Belastungen. Weil die Diagnose von Dr. Binz so nicht anerkannt wurde, musste Brigitte zur Begutachtung zum Medizinischen Dienst. Wie sie dort behandelt wurde, welche zum Teil dreisten und überflüssigen Fragen gestellt wurden, brachte sie fast zur Verzweiflung. Die Krönung: Ihrem Rentenantrag wurde Monate später nur aufgrund des Entlassungsberichtes aus der stationären psychotherapeutischen Behandlung stattgegeben. Mit der Diagnose MCS allein wäre der Antrag nicht bewilligt worden. Aber zu welchem Preis: Brigitte erlebte, dass sie als MCS-Kranke stigmatisiert und einmal mehr psychiatrisiert wurde.
Sie fühlte sich allein gelassen, ohne Unterstützung und Hilfe. Ein Neurologe vor Ort, den Sie wegen der langen Fahrt zu Dr. Binz als Alternative kontaktierten, zog alle Diagnosen in Zweifel und verdammte diese als Scharlatanerie. Als Höhepunkt bekam sie ein Rezept über Psychopharmaka in die Hand gedrückt.
Neue Umgebung
Zu diesem Zeitpunkt begannen sie und ihr Mann die Suche nach einem neuen Zuhause. Nach sechs Monaten Suche fanden sie eine aus ihrer Sicht geeignete Mietwohnung. Die mit der Wohnungssuche verbundenen Belastungen wie Besichtigungen, altes Haus ausmisten, Kartons packen, Kartons in die neue Wohnung fahren, neue Wohnung einrichten, altes Haus herrichten und verkaufen, all das für Nicht-Kranke Übliche, waren für Brigitte zu viel. Regenerationskuren folgten, aber nachhaltige Linderung brachten sie nicht.
Ein behandelnder Arzt stellte zu den vorhandenen Symptomen eine „Potenzierung der psychischen und toxischen Schäden“ fest. Dazu kamen diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten, weitere Minderung des Hörvermögens und der Durchhaltefähigkeit, Medikamentenunverträglichkeiten u.w.m.
Verschlimmerung
Brigittes Zustand in der neuen Wohnung verschlechterte sich kontinuierlich. Sie verstand nicht warum. Die neu eingerichteten Räume sahen gut aus: Parkett- und Linoleum-Böden, Flur, Küche und Bad gefliest. Vinyltapeten frisch gestrichen. Sie putzte die Wohnung, hielt alles in Ordnung. Sogar für einen Computerkurs fand Sie Zeit. Sie fing an, sich bei CSN und auf anderen Webseiten über MCS zu informieren, aber ihre geringe mentale Aufnahmefähigkeit verhinderte, dass sie verstand, was sie las. Sie konnte die Zusammenhänge nicht dauerhaft erkennen, manches wurde schlichtweg vergessen.
Nebenher unterstützten Brigitte und ihr Mann Bewohnerinnen des gegenüberliegenden Seniorenheimes. Sie lasen ihnen vor, unterhielten sich mit ihnen, gingen zusammen spazieren. Sie versuchten ein ihren Vorstellungen entsprechendes Leben zu führen, soweit Brigittes Krankheit es eben zuließ.
So merkte sie lange Zeit nicht, dass verschiedene Ausdünstungen zur Vernebelung des Geistes beitrugen. Sie ahnte nicht, dass die Weichspülerdüfte aus der gemeinsamen Waschküche ihr zusetzten. Sie wusste zwar, dass es Elektrosensibilität gibt. Sie sah die Sendemasten für Mobilfunk, maß ihnen aber zunächst keine Bedeutung bei. Später einmal wird Brigitte schreiben: „Ich habe die Krankheit lange nicht verstanden und jetzt im Schnelltempo erleben müssen, was es heißt.“
Der Zusammenbruch
Der örtliche Wasserversorger musste im Jahr 2008 seine Talsperre sanieren. Die Stadt, in der sie wohnte, stellte die Versorgung auf Grundwasserbrunnen um. Keime im Wasser führten dazu, dass das Trinkwasser gechlort abgegeben werden musste. Brigitte nutzte dieses Wasser täglich: Waschen, duschen, kochen, trinken.
Zudem war Brigitte mitten in die Einflugschneise des Köln-Bonner Flughafens gezogen. Tag und Nacht flogen die Flugzeuge über ihr Haus. Da der Flughafen über ein radargesteuertes automatisches Landesystem (ILS) verfügt, kam zum Funkverkehr und übermäßigem Lärm eine ständige Radarbelastung hinzu.
Im Herbst 2008 besuchten Brigitte und ihr Mann ein Konzert in Siegburg. Der Saal war voll, Besucherinnen trugen Parfüm, die Männer umwaberte Deogeruch. Das Konzert war großartig, mit einer Bühnenshow, die als Höhepunkt ein Lichtgewitter, Nebelschwaden und ein Minifeuerwerk vorsah. Mitten in diesem Höhepunkt musste Brigitte schlagartig den Saal verlassen. Sie konnte den Gestank, den Rauch, einfach alles nicht mehr auszuhalten!
In den nächsten Tagen und Wochen fühlte sich Brigitte einfach nur schlecht. Die Schlafstörungen nahmen zu, das Brennen im Körper, ihr Körpergewicht reduzierte sich. Alles tat weh. Ohnehin schon lärmempfindlich sorgte der Fluglärm für eine Kakophonie in Brigittes Ohren.
Nur ganz langsam konnte sie sich mit Hilfe ihrer Freundin, die ebenfalls MCS hatte, mit Abwehrmaßnahmen beschäftigen: Gegen die Weichspüler-Düfte wurde ein Untertürschutz angebracht. Das DECT-Telefon wurde zunächst gegen ein Eco-DECT-Telefon ausgetauscht, dann nochmals gegen ein ISDN-Tastentelefon. WLAN wurde komplett abgeschaltet und der Internetzugang per Kabel hergestellt; Energiesparbirnen gegen normale Glühlampen ausgewechselt. Doch Brigittes Zustand stabilisierte sich nicht. Sie spürte die Batterie in einer Armbanduhr. Außenkontakte wurden eingestellt. Nur die Freundin durfte sie noch besuchen, weil sie „nach nichts roch“.
Ihr Ehemann sah die Veränderungen, aber er verstand sie nicht. Im nagelneuen Auto konnte er Brigitte nicht mehr zu einem der wenigen, verständigen (!) Umweltärzten fahren, die es in Deutschland gibt und die vielleicht noch hätten helfen können.
Mitte 2009 wog Brigitte nur noch 46 Kilogramm. Die Symptome hatten Sie fest im Griff. Sie konnte sich nicht allein waschen, kam nicht in die Badewanne hinein, geschweige denn hinaus. Dazu die ständigen Schmerzen, die Hoffnungslosigkeit, jemals aus dieser Wohnung herauszukommen. Kein Fenster durfte mehr geöffnet werden, wenn Brigitte im Raum war, die Haustür nur ganz kurz für ein schnelles Raus/Rein. Jedes kleinste Geruchsmolekül wurde von Brigitte wahrgenommen, jedes elektrische Gerät. Die Atemschutzmaske war ihr ständiger Begleiter.
Silvia Müller telefoniert mit ihr, schickte Sauerstoff und Keramikmaske. Dazu weitere Ratschläge. CSN half! Kein Arzt, keine Krankenkasse, kein Nachbar, kein Angehöriger und schon gar keine andere Stelle.
Ganze Tage hat sie ihr Schlafzimmer nicht verlassen. Die Hypersensibilisierung nahm zu. Zwei neue Schränke rochen zu stark. Also raus mit den Schränken, Nachbarn aus dem Ort konnten sie gebrauchen.
Brigittes stellte ihre Nahrung um und zog einen Baubiologen hinzu: Er fand heraus, dass im Mietshaus ein DECT-Telefon 1000-fach (!!!) über dem Normwert strahlte. Die Wohnung lag im Mittelpunkt der Radarstrahlen. Die Fußböden aus Linoleum gasten ebenso aus wie die Vinyltapeten und der Kleber des Parketts. Die Katastrophe war perfekt. Wohin mit der total geschwächten Brigitte?
Erste Verlegung
Der Baubiologe empfahl ein Seminarhaus mit Netzfreischaltung in Hessen. Sofort wurde Kontakt aufgenommen, ein Doppelzimmer reserviert, sich nach der Netzfreischaltung erkundigt. Die Wartezeit bis ein Zimmer frei war, dauerte zu lange. Per Telefon setzte sie verzweifelt ihren Hilferuf ab: „Ich halte es hier nicht mehr aus! Holt mich dringend ab! Mit jedem Flugzeug zittert mein Körper und es hört nicht auf.“ Brigitte war schreiend vor Schmerzen zusammengebrochen. Was tun? Kurzfristig wurde sie zu ihrer Freundin gebracht, wo sie nur eine Nacht verbrachte. Die Wohnung war auch nicht perfekt, aber in Bezug auf den Elektrosmog besser und sie lag nicht mehr in der Einflugschneise. Laut war es immer noch.
Am 23. Mai startete die Verlegung nach Hessen. Alles sah nett aus. Das Haus von außen schön, das Zimmer innen einfach, sauber, für Nichtkranke keine übermäßigen Gerüche. Doch welch ein Schock! Es wurde gebaut. Ein Teil der Baustelle lag direkt unter dem Zimmer und das wurde bei der Reservierung nicht erwähnt. Für Brigitte war es zu laut, der Schulweg und die Waldschule in unmittelbarer Nähe, der Bauer mähte und fuhr mit dem Trecker dauernd hin und her. Brigitte kam nicht mehr aus dem Zimmer, der total geschwächte Körper ließ nur wenige Schritte zu. Das Essen war auch nicht richtig, die Angestellten rochen nach Parfüm,…Wiederholte sich die Katastrophe?
Zweite Verlegung
Mit einem Wort – Ja! Zwei Tage brauchte es, um für Brigitte einen neuen Aufenthaltsort zu finden. Es gibt in Thüringen einen Platz, an dem sich Elektrosensible aufhalten können. Kein Strom auf dem Zimmer, nicht auf der Etage, nur in den Servicebereichen des Hauses. Damit auch: Kein Radio, kein Fernsehen. Noch wichtiger: Kein Radar und in unmittelbarer Nähe keine Landwirtschaft. Mobilfunkverbot im Haus, keine großen Straßen, kein Fluglärm, ein Naturschutzgebiet.
27. Juni 2009: Zum Glück liegt der neue Ort nur eine knappe Autostunde entfernt. Wieder hoffte Brigitte, dass diesmal alles klappen würde. Aber tief drinnen hatte sie Zweifel, die sie ihrer Freundin im letzten Telefonat schilderte. Sie lebte mit einem immer schwächer werdenden Körper und der ständigen Zunahme der Empfindsamkeit.
Die letzten Tage
Jetzt war ihr Ehemann noch mehr gefordert. Kochen, einkaufen, sie nach draußen begleiten. Drei Wochen lang versuchte er alles für sie zu tun. Auf dem Zimmer lagen am ersten Tag kleine Seifenstückchen. Voller Verzweiflung forderte Brigitte, dass diese entfernt werden.
Dennoch hatte sie stundenlange Zitteranfälle, Sprach- und Schlafstörungen. Sie wurde gereizter und aggressiver. Brigitte war nicht mehr Herrin ihrer selbst. Vor allem nachts traten schreckliche Halluzinationen auf. Mehrfach konnte ihr Mann verhindern, dass sie sich aus dem Fenster stürzte.
Alle Mühen waren vergebens. Die Hypersensibilität schlug erbarmungslos zu.
Brigittes letzte Worte waren:
„Liebe Freundin!
Ich erleide Höllenqualen, ich bin verzweifelt, habe unendliche Schmerzen. Mein Körper richtet sich gegen sich selbst. Meine eigenen Berührungen lösen Schmerzen aus. […] jedes Geräusch bedeutet Schmerzen. Selbst wenn ich esse, habe ich Schmerzen.
Ich habe Heimweh wie verrückt, aber ich habe kein Zuhause mehr, ich weiß nicht einmal wohin. Ohne Maske kann ich nicht raus. In den Wald kann ich nicht, soweit kann ich nicht gehen.
[…] Ich kann mit niemanden sprechen, tut auch schon weh und alle haben irgendeinen Duft an sich.
Nachts läuft die Hölle auf Hochtouren. Panik! Dann stehe ich im Fensterrahmen und will springen. Ich kann nichts dagegen tun, es läuft automatisch ab. Zittern ohne Ende und Schmerzen. Schreien ins Kissen, weil ich es nicht mehr aushalten kann. […]“
Brigitte schied am 21. Juli 2009 gegen 11:00 Uhr aus dem Leben.
Autoren: Bea und Michael Muth für CSN – Chemical Sensitivity Network, 30. Juli 2009




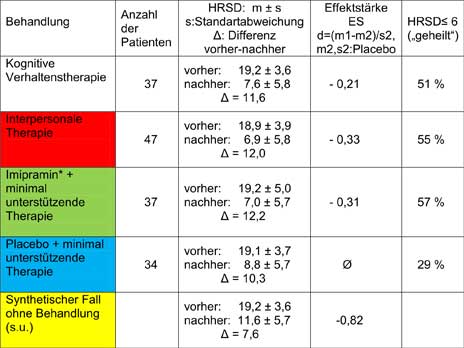
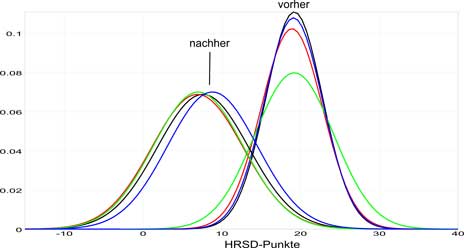
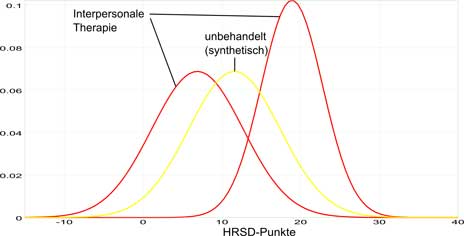



 Multiple Chemical Sensitivity (B02.19.00)
Multiple Chemical Sensitivity (B02.19.00)

