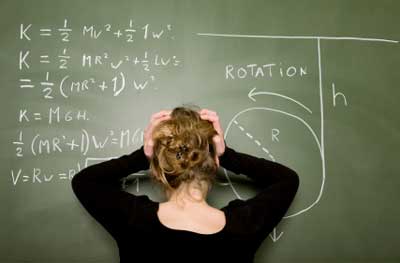Weichspüler kann den Atem rauben
Weichspüler verschmutzen nachgewiesenermaßen unsere Gewässer, doch was nur Wenige wissen, der unnötige Waschzusatz kann auch die Gesundheit erheblich beeinträchtigen. Im Mäuseversuch wurde durch ein US Forschungslabor bestätigt, dass viele Menschen sich zu Recht über Gesundheitsbeschwerden durch Weichspülergeruch beschweren, denn auch die Versuchstiere reagierten erheblich auf die Ausdünstungen von handelsüblichen Weichspülern, und Mäuse lügen bekanntermaßen nicht.
Gesundheitsbeschwerden durch Weichspüler
Weichspüler sind trotz dass sie problematische Substanzen für unsere Umwelt darstellen immer noch in vielen Haushalten im ständigen Gebrauch. Wäsche, die einmal damit gewaschen wurde, „duftet“ über lange Zeit oder präziser gesagt: Sie dünstet gesundheitsschädliche Chemikalien aus. Allergiker, Asthmatiker und insbesondere chemikaliensensible Personen beklagen sich immer wieder, dass bei ihnen Weichspülergeruch erhebliche Gesundheitsbeschwerden auslöst. In Einzelfällen kann dies soweit führen, dass eine betroffene Person aus einem Haus ausziehen muss, weil der Nachbar ständig mit Weichspüler gewaschene Wäsche im Garten oder auf dem Balkon aufhängt und dadurch die gesundheitlichen Beschwerden im Lauf der Zeit unerträglich werden.
Menschen kann man als Simulanten hinstellen, Mäuse nicht
„Das kann doch überhaupt nicht sein, auf Weichspüler kann man gar nicht reagieren, was für ein Spinner“, so oder ähnlich klingt oft die Rede eines uneinsichtigen Weichspüleranwenders, den ein Nachbar verzweifelt um Rücksicht bittet. Dass es sehr wohl sein kann, dass eine Person auf Weichspülerausdünstungen reagiert, liegt auf der Hand, denn herkömmlicher Weichspüler enthält eine erhebliche Anzahl von Chemikalien. Ein Labor in Vermont konnte die Auswirkungen im Tierversuch eindeutig nachvollziehen, so dass nun auch der letzte Zweifel erlöschen muss. In einer kontrollierten Studie untersuchte Anderson Laboratories, ein Speziallabor für Schadstoffanalytik, ob es eine biologische Ursache für die akuten nachhaltigen Beschwerden von bestimmten Personen, beispielsweise Menschen mit Chemikalien-Sensitivität (MCS) oder mit Asthma, auf Weichspüler gibt. Dafür wurden verschiedene Tests mit Mäusen durchgeführt, bei denen die Tiere den Emissionen von 5 verschiedenen handelsüblichen Weichspülern für 90 Minuten unter verschiedenen Testbedingungen ausgesetzt wurden. Der Testverlauf wurde per Video dokumentiert.
Präziser Untersuchungsablauf
Sensoren zur Feststellung der Lungenfunktion und eine computergestützte Version der ASTM Testmethode E-981 wurden vom Anderson Team verwendet, um die akuten Veränderungen in verschiedenen Atmungszyklen bei den Versuchstieren festzustellen. Ganz spezielles Augenmerk wurde hierbei auf die Atempause nach dem Einatmen und die Pause nach dem Ausatmen, als auch auf den Luftfluss in der Mitte der Ausatmungsgeschwindigkeit gelegt. Die Wissenschaftler untersuchten die stattfindenden Veränderungen bei fünf verschiedenen Weichspülern und achteten dabei insbesondere auf sensorische Irritationen (SI), pulmonale Irritationen (PI) und die Einschränkungen im Luftfluss (AFL) in Bezug auf eine sich verändernde Intensität.
Auch Mäuse reagieren auf die Chemikalien in Weichspüler
Am Höhepunkt des jeweils eintretenden Effektes auf Weichspülergeruch bei den Versuchstieren erstreckten sich die sensorischen Irritationen auf 21 bis 58% der Atemzüge. Nach drei Expositionen wurde eine krankhafte Veränderung in Form einer leichten Entzündung in den Lungen der Mäuse festgestellt. Analysen aus den Emissionen eines Weichspülertuchs wurden mittels gaschromatographischer Massenspektrometrie durchgeführt. Die Wissenschaftler identifizierten verschiedene bekannte irritative Substanzen, dazu zählten die aromatischen Kohlenwasserstoffe Isopropylbenzol, Styrol und Trimethylbenzol, sowie Phenol und das Monoterpen Thymol.
Langanhaltender gesundheitsschädlicher Effekt
Wäsche, die bereits mit einem der Weichspülertücher getrocknet wurde, emittierte Chemikalien, die ausreichten, um während des Höhepunktes des Effekts, eine sensorische Irritation bei 49% der Atemzüge auszulösen. Das Auslegen eines Weichspülertuches über Nacht in einem kleinen Raum, was dem Trocknen in einem Bad oder einer kleinen Küche gleichkommt, führte zu einer Atmosphäre, die eine deutliche sensorische Irritation bei 61% der Atemzüge auslöste.
Ohne Weichspüler waschen ist gesünder
Die Ergebnisse der Wissenschaftler von Anderson Laboratories, demonstrieren ganz unverkennbar, dass einige handelsübliche Weichspüler Chemikalien freisetzen, die dazu in der Lage sind, erhebliche Atemwegsbeschwerden auszulösen. Sie verursachten sensorische und pulmonale Irritation, sowie einen reduzierten Luftfluss in der Mitte der Ausatmungsphase bei normalen Mäusen. Diese Forschungsergebnisse bieten klare toxikologische Grundlage für eine Erklärung, warum einige Menschen schwere gesundheitliche Reaktionen auf Weichspülerausdünstungen erleiden.
Autor: Silvia K. Müller, CSN – Chemical Sensitivity Network, Mai 2008
Literatur:
Anderson RC, Anderson JH., Respiratory toxicity of fabric softener emissions, J. Toxicol Environ Health A. 2000 May 26;60(2):121-36.