WHO veröffentlicht im Rahmen der Leitlinien zur Raumluftqualität erste Leitlinien zu Feuchtigkeit und Schimmel

Die WHO veröffentlicht heute ihre ersten Leitlinien zur Raumluftqualität, die sich konkret mit dem Thema Feuchtigkeit und Schimmel befassen. (1) Diese Leitlinien sind das Ergebnis einer eingehenden zweijährigen Prüfung des aktuellen Wissensstands durch 36 führende Sachverständige aus aller Welt unter der Federführung des WHO-Regionalbüros für Europa. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass Menschen, die sich in feuchten oder von Schimmel befallenen öffentlichen wie privaten Gebäuden aufhalten, ein um bis zu 75% höheres Risiko tragen, an Atemwegsbeschwerden und Asthma zu leiden. In den Leitlinien wird die Verhütung oder Behebung von Feuchtigkeits- und Schimmelproblemen empfohlen, um Schäden an der Gesundheit wesentlich zu reduzieren.
„Da die Menschen einen Großteil ihres Alltags zu Hause, in Büros, Schulen, Gesundheitseinrichtungen oder anderen Gebäuden verbringen, ist die Luftqualität in diesen Räumen für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung“, sagt Dr. Srdan Matic, Leiter des Referats Nichtübertragbare Krankheiten und Umwelt beim WHO-Regionalbüro für Europa. „Mit diesen Leitlinien werden den Gesundheitsbehörden und anderen Behörden zum ersten Mal Wege aufgezeigt, wie ein sicheres und gesundes Raumklima erreicht werden kann. Wir sind der Ansicht, dass diese Arbeiten dazu beitragen werden, die Gesundheit der Menschen überall auf der Welt zu verbessern.“
Diese Publikation steht am Beginn einer Reihe von WHO-Leitlinien zur Raumluftqualität. Diese sollen weltweit anwendbar sein, um den Schutz der Gesundheit unter verschiedenen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen zu ermöglichen. Weitere Veröffentlichungen zu bestimmten Chemikalien und Verbrennungsprodukten befinden sich in Arbeit. In ihrer Gesamtheit enthalten die Leitlinien die ersten umfassenden evidenzbasierten Empfehlungen zur Bekämpfung von Verunreinigungen der Innenraumluft, einer der weltweit häufigsten Ursachen von Tod und Krankheit.
Weltweit stehen jährlich etwa 1,5 Millionen Todesfälle, hauptsächlich bei Frauen und Kindern in Entwicklungsländern, mit der Verbrennung fester Brennstoffe in Innenräumen in Verbindung. Allein in der Europäischen Union (EU) sind Verbrennungsprozesse, Chemikalien in Baustoffen und Feuchtigkeit für den Verlust von mehr als 2 Millionen gesunden Lebensjahren aufgrund vorzeitiger Mortalität oder chronischer Krankheiten wie Asthma und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich.
In vielen EU-Ländern haben 20-30% der Haushalte mit Feuchtigkeitsproblemen zu kämpfen. Alles deutet darauf hin, dass dies eine Gefährdung für die Gesundheit darstellt. In feuchten Innenräumen wachsen Hunderte Arten von Bakterien und Pilzen, die Sporen, Zellfragmente und Chemikalien freisetzen. Eine Belastung durch diese Schadstoffe wird mit dem Auftreten bzw. der Verschlimmerung von Atemwegsbeschwerden, Allergien, Asthma und Immunreaktionen in Verbindung gebracht. Kinder sind in besonderem Maße gefährdet. Neuesten Daten zufolge könnten 13% aller Fälle von Asthma im Kindesalter in den entwickelten Ländern der Europäischen Region der WHO auf feuchte Wohnräume zurückzuführen sein.
Das Wissen um die Luftschadstoffe in geschlossenen Räumen ist der Schlüssel zu Maßnahmen zur Verhütung gesundheitlicher Beeinträchtigungen und zur Reinhaltung der Luft. Viele dieser Maßnahmen entziehen sich dem einzelnen Nutzer oder Bewohner von Gebäuden und müssen daher von den Behörden initiiert werden. Die in den Leitlinien empfohlenen Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass bei Konzeption, Bau und Instandhaltung von Gebäuden sachgerecht vorgegangen wird und geeignete Regelungen für Wohnen und Gebäudebelegung aufgestellt werden. Es ist Aufgabe der Gebäudeeigentümer, ein gesundes, von Feuchtigkeit und Schimmel freies Arbeits- bzw. Wohnumfeld bereitzustellen, indem sie für ausreichende Isolierung sorgen. Dagegen ist es Aufgabe der Gebäudenutzer, durch angemessene Nutzung von Wasser, Heizung und Lüftung übermäßige Feuchtigkeit zu vermeiden.
„Da bisher keine klaren Erkenntnisse vorlagen, waren Baunormen und -vorschriften nicht ausreichend auf die Verhütung und Eindämmung von überhöhter Feuchtigkeit ausgerichtet. Die neuen Leitlinien sind deswegen so wichtig, weil sie Bezugskriterien dafür liefern, was gesunde Raumluft bedeutet.“ Zu diesem Schluss kommt Dr. Michal Krzyzanowski, Regionalbeauftragter für Nichtübertragbare Krankheiten und Umwelt beim WHO-Regionalbüro für Europa und Leiter des WHO-Projekts zur Erstellung der Leitlinien. „Bei der Ausarbeitung der Leitlinien wurden mehr als 100 Studien zu den Auswirkungen einer feuchten Umgebung auf die Gesundheit herangezogen. Dieses Indizienmaterial bildet das Gerüst der Leitlinien und liefert eine solide Handlungsgrundlage.“
Weitere Informationen über Luftqualität und Gesundheit finden sich auf der Website des Regionalbüros.
Literatur:
WHO guidelines on indoor air quality: dampness and mould. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, Kopenhagen und Bonn, 16. Juli 2009.
Anm: Bisher gibt es die Leitlinie nur in englischer Sprache: Indoor Air Quality Guidelines on Dampness and Mould



 Neben der Psychotherapie ist auch die medikamentöse Therapie bei psychischen Problemen, oder was man dafür hält, heute weit verbreitet. Von deren Verfechtern erfährt der Kranke nichts über sein verdrängtes Sexualleben sondern wird über die Defizite seiner Hirnchemie aufgeklärt. Auch hier kommt ihm der kulturell gelernte Glaube an die Effektivität von Medikamenten und die Macht und Autorität der Wissenschaft zu Gute. Um derartige Effekte zu berücksichtigen, wird die Wirksamkeit in doppelt blinden Placebo Vergleichsstudien ermittelt, was bei Psychotherapien leider nicht geht. (Auf Probleme im Zusammenhang mit Nebenwirkungen soll in diesem Beitrag nicht eingegangen werden.)
Neben der Psychotherapie ist auch die medikamentöse Therapie bei psychischen Problemen, oder was man dafür hält, heute weit verbreitet. Von deren Verfechtern erfährt der Kranke nichts über sein verdrängtes Sexualleben sondern wird über die Defizite seiner Hirnchemie aufgeklärt. Auch hier kommt ihm der kulturell gelernte Glaube an die Effektivität von Medikamenten und die Macht und Autorität der Wissenschaft zu Gute. Um derartige Effekte zu berücksichtigen, wird die Wirksamkeit in doppelt blinden Placebo Vergleichsstudien ermittelt, was bei Psychotherapien leider nicht geht. (Auf Probleme im Zusammenhang mit Nebenwirkungen soll in diesem Beitrag nicht eingegangen werden.)

 1. Dieser Punkt liegt auf der Handgelenksfalte, innen am Handgelenk, in einer Linie mit dem kleinen Finger. Sie können eine kleine Vertiefung tasten. Erst auf der einen, dann auf der anderen Seite einige Minuten massieren. Merken Sie sich diesen Punkt auch, wenn Sie öfters nicht schlafen können oder nervös sind, er hilft, zur Ruhe zu kommen.
1. Dieser Punkt liegt auf der Handgelenksfalte, innen am Handgelenk, in einer Linie mit dem kleinen Finger. Sie können eine kleine Vertiefung tasten. Erst auf der einen, dann auf der anderen Seite einige Minuten massieren. Merken Sie sich diesen Punkt auch, wenn Sie öfters nicht schlafen können oder nervös sind, er hilft, zur Ruhe zu kommen.  2. Ein weiterer Punkt liegt auf der Innenseite des Unterarms, auf der Mitte zwischen den beiden hier tastbaren Sehnen. Zwei Daumenbreiten entfernt von der Beugefalte des Handgelenks. Kräftiger, massierender Druck mit dem Zeigefinger oder Daumen, auf jeder Seite 1-2 Minuten.
2. Ein weiterer Punkt liegt auf der Innenseite des Unterarms, auf der Mitte zwischen den beiden hier tastbaren Sehnen. Zwei Daumenbreiten entfernt von der Beugefalte des Handgelenks. Kräftiger, massierender Druck mit dem Zeigefinger oder Daumen, auf jeder Seite 1-2 Minuten. Akut, wenn Ihnen schwindlig wird, z.B. nach schnellem Aufstehen oder bei Hitze, oder wenn sie sich fühlen, als würden Sie „umkippen“ setzen Sie sich schnell hin und drücken Sie den Punkt zwischen Nase und Oberlippe fest mit einer Fingerkuppe für einige Minuten. Dieser Punkt stabilisiert wieder den Kreislauf.
Akut, wenn Ihnen schwindlig wird, z.B. nach schnellem Aufstehen oder bei Hitze, oder wenn sie sich fühlen, als würden Sie „umkippen“ setzen Sie sich schnell hin und drücken Sie den Punkt zwischen Nase und Oberlippe fest mit einer Fingerkuppe für einige Minuten. Dieser Punkt stabilisiert wieder den Kreislauf.  Ein Punkt, der mehr Energie gibt und den Kreislauf stärkt, liegt am Bein. Legen Sie Ihre Hände im Sitzen, Beine im rechten Winkel gebeugt, auf die Kniescheiben. Etwa wo der Ringfinger liegt, können Sie eine Vertiefung ertasten. Möglichst an beiden Seiten zugleicht kräftig mit je einer Fingerkuppe für ein oder zwei Minuten pressen.
Ein Punkt, der mehr Energie gibt und den Kreislauf stärkt, liegt am Bein. Legen Sie Ihre Hände im Sitzen, Beine im rechten Winkel gebeugt, auf die Kniescheiben. Etwa wo der Ringfinger liegt, können Sie eine Vertiefung ertasten. Möglichst an beiden Seiten zugleicht kräftig mit je einer Fingerkuppe für ein oder zwei Minuten pressen.

 Vergangene Woche wurde in der Onlinezeitung
Vergangene Woche wurde in der Onlinezeitung 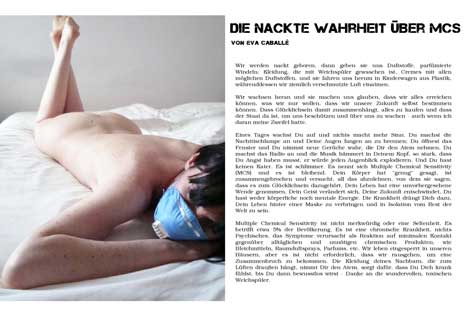
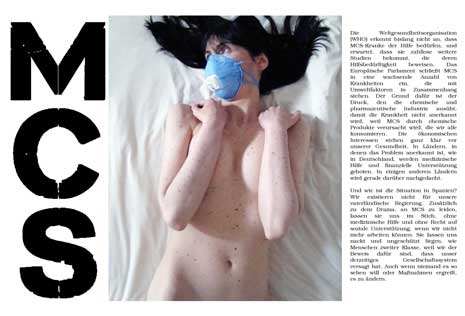
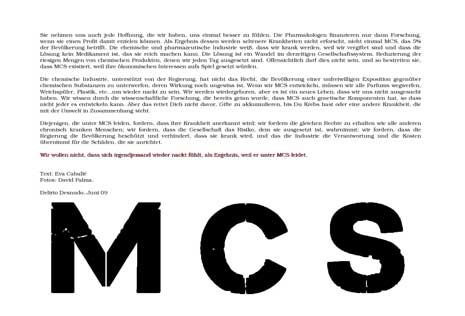
 Auf Platz Eins landete im Juni ein englischsprachiger Artikel aus dem neuen Blog auf der CSN Plattform, dem
Auf Platz Eins landete im Juni ein englischsprachiger Artikel aus dem neuen Blog auf der CSN Plattform, dem