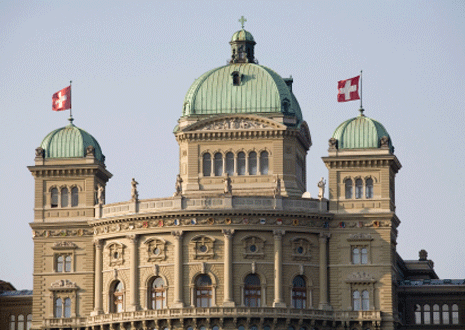Feuerwerk: Gesundheitsgefahr durch Feinstaubproblematik

Feuerwerk ist – neben allen anderen zur Genüge bekannten Problemen wie z.B. Explosionsschäden, Verbrennungen, Augen- und Ohrenschäden, Kinderarbeit etc. – in erster Linie ein Feinstaubproblem! Die Feinstaubwerte über den Nationalfeiertag der Schweiz sowie an Silvester belegen dies auf eindrucksvolle Weise.
Bei der Verbrennung von Feuerwerkskörpern (Kracher, Raketen, etc.) wird eine Mischung an chemischen Stoffen explosionsartig freigesetzt. Beim Abbrennen laufen zwischen den vermengten Stoffen chemische Reaktionen ab; dabei bilden sich eine Vielzahl neuer Substanzen unbekannter Zusammensetzung und Giftigkeit. Dadurch, dass die stark zerklüftete Oberfläche der feinen Staubteilchen eine Anlagerung von weiteren toxischen Substanzen ermöglicht, die so in den Körper getragen werden, verstärkt sich die gesundheitsschädigende Wirkung des Staubes. An Feiertagen, an denen viel Feuerwerk abgebrannt wird, sind es primär Schwermetallverbindungen, die sich an den Staubpartikeln festsetzen.
Fakt ist:
Es gibt grössere Feinstaubquellen als Feuerwerk; doch es gibt keine Feinstaubquelle, die wie Feuerwerk binnen kürzester Zeit eine Feinstaub-belastung erwirkt, welche den Feinstaubgrenzwert um das 30-fache (z. B. Feinstaubwerte Nationalfeiertag Schweiz) und mehr überschreitet.
Feinstaub kann nicht nur bestehende Krankheiten verschlimmern, sondern auch neue hervorrufen, dadurch betrifft die Feinstaubproblematik uns alle und kann nicht als das Problem einiger weniger abgetan werden.
Ein Schwellenwert für Feinstaub, unter welchem keine schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit auftreten, wurde bis heute nicht gefunden.
Gesundheitliche Einbussen durch hohe Feinstaubbelastungen erleiden als Erste:
- Ungeborene, Säuglinge und Kleinkinder
- Personen mit Erkrankungen der Atemwege (Asthma, COPD/Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Lungenemphysem, -krebs etc.) und des Herzkreislaufsystems
- Personen mit Persistent Hyperreactivity (multiple chemical sensitivity, TILT/Toxicant-Induced Loss of Tolerance, CFS/Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgie etc.) und Low-Dose RADS/Reactive Airways Disfunction Syndrome
- über 65-Jährige
Eine akut erhöhte Partikelbelastung kann zu folgenden Gesundheitsauswirkungen führen:
- entzündliche Prozesse
- gravierende Intoleranz-Reaktionen der Lunge mit ebenfalls schwerwiegenden Folgereaktionen sämtlicher Körperorgane
- negativen Auswirkungen auf das Herzkreislaufsystem (z.B. Herzinfarkt)
- Zunahme des Medikamentengebrauchs
- Zunahme der Krankenhauseinweisungen wegen Atemwegs- und Herzkreislaufproblemen
- erhöhte Sterblichkeit
Eine grobe Fraktion von PM10, (die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel mit aerodynamischem Durchmesser kleiner als 10 µm) ist stärker mit Husten, Asthmaanfällen und respiratorischer Mortalität assoziiert (vor allem akute Wirkungen), dagegen sind die feinen Anteile stärker mit Herzrhythmusstörungen und kardiovaskulärer Mortalität korreliert.
Feuerwerk und die Tage danach
In Zeitreihenstudien treten Wirkungen auf die respiratorische Mortalität einen Tag nach der erhöhten Partikelbelastung auf. Wirkungen auf die kardiovaskuläre Mortalität sind nach etwa 4 Tagen am stärksten sichtbar.
Die Partikelgröße bestimmt ihre Verweildauer in der Atmosphäre. Während PM10 binnen Stunden durch Ablagerung und Niederschlag aus der Atmosphäre verschwinden, können PM2.5 Tage und Wochen in ihr schweben. Folglich können diese Partikel über weite Strecken transportiert werden.
Feinstaub kommt durch jede Ritze
So lange unsere Häuser nicht luftdicht sind, reicht für gesundheitlich Schwerstbetroffene der Aufenthalt hinter geschlossenen Türen und Fenstern als Schutz vor Feuerwerksemissionen meistens nicht aus.
Mediziner setzt Politik in Kenntnis
Dr. med. G. Schwinger aus Deutschland beschreibt diese Problematik in seinem Brief vom 22.12.2004 an die Bundesfraktion Bündnis 90/Die Grünen auf eindrucksvolle Weise:
„… Wir betreuen Patienten/innen, die (unabhängig von Allergien) bereits an einer erworbenen hochgradigen Intoleranz leiden, die dann zu einem spez. hyperreagiblen Bronchialsystem und Gefäßsystem führt mit der gravierenden Folge spez. undiff. systemischer Misch-Kollagenosen mit Overlap-Syndromen, verursacht insbesondere durch Pyrolyseprodukte und (hauptsächlich deren) Feinstäube. … Diese Patienten/innen müssen bereits am 30.12. d.J. sämtliche Türen und Fensterspalten (natürlich nur unzureichend) mit spez. Tapes zukleben, weil durch die o.g. extrem lebensgefährlichen Explosionen i.S. eines >>Over-Exposure<< (in den Aussenbereichen der Wohnungen) auch erhebliche Innenraumbelastungen auftreten, die dann zu neuerlichen schweren inhalativen Intoxikationen im Niedrig-dosis-bereich führen – mit generalisierten neuro-endokrinen und immun-vaskulären systemischen Folgereaktionen. Für diese Patienten/innen sind die Tage um Silvester insofern – nahezu regelmässig – eine einzige grosse gesundheitliche Katastrophe – für Tage und Wochen. …“
Anm: Der ganze Brief kann bei Stop Fireworks nachgelesen werden.
Gesundheitsschädliches Potential ist wissenschaftlich abgehandelt
Es gibt mittlerweile genügend neuere wissenschaftliche Arbeiten, die diese Feuerwerksproblematik belegen, wie z.B.:
„Ambient air quality of Lucknow City (India) during use of fireworks on Diwali festival“, 2008, by Barman SC et al.
„Emissions and accumulation of metals in the atmosphere due to crackers and sparkles during Diwali festival in India“, 2004, by Kulshrestha UC et al.
„Recreational atmospheric pollution episodes: Inhalable metalliferous particles from firework displays“, 2007, by Moreno T et al.
„Short-term variation in air quality associated with firework events: a case study“, 2003, by Ravindra K et al.
„The impact of fireworks on airborne particles“, 2008, by Vecchi R et al.
„Heavy metals from pyrotechnics in New Years Eve snow“ 2008, by Steinhauser G et al.
Mehr Informationen zu diesem Thema lassen sich unter „Wissenschaftliche Artikel“ auf Stop Fireworks finden.
Deutsche und Schweizer Behörden warnen vor Feuerwerk
U.a. empfehlen mittlerweile Schweizer Behörden, Menschen mit Erkrankungen der Atemwege und Kreislauferkrankungen sollten Feuerwerke meiden. Das Umweltbundesamt/Deutschland äusserte sich im November 2007 im Hintergrundpapier „Zum Jahreswechsel: Wenn die Luft „zum Schneiden“ ist“ zur Feuerwerks-Feinstaubproblematik und appellierte gleichzeitig an die Bürger/Innen, als Beitrag zur Verminderung der Feinstaubbelastung in der Silvesternacht das persönliche Feuerwerk einzuschränken oder sogar ganz darauf zu verzichten.
Auch die American Lung Association warnt vor Feuerwerk
Die American Lung Association of Hawaii rät Lungenkranken seit Jahren, während der schlimmsten Feuerwerkerei zuhause bei geschlossenen Türen und Fenstern und mit laufender Klimaanlage oder Luftreinigungsapparat zu bleiben und eine Gesichtsmaske zu tragen, um die Raucheinatmung zu verringern. Dieses Jahr verkündet das National Epidemiology Center/Philippinen dasselbe. etc.
Dem Schutz der Gesundheit und Umweltschutz Priorität einräumen
Das heisst, dass sich sowohl zumindest manche Behörden als auch zumindest Teile der Ärzteschaft absolut darüber im Klaren sind, wie schädlich Feuerwerksemissionen sind.
Ob Feuerwerk „richtig“ oder „falsch“ abgebrannt wird, von Laien im Hinterhof oder von speziell dazu Ausgebildeten als Grossfeuerwerk: die Emissionen bleiben letztendlich dieselben. Bereits ein kleines Feuerwerk (unter dem Jahr) kann in seiner näheren Umgebung zu einer erheblichen kurzzeitigen Erhöhung der Feinstaubwerte führen.
Die Begeisterung für Licht und Knall von Feuerwerk darf nicht dazu führen, das Umweltverschmutzungspotential von Feuerwerk zu ignorieren. Feinstaubempfindliche Menschen dürfen auf keinen Fall als „Kollateralschaden“ der Feuerwerkerei einiger weniger billigend in Kauf genommen werden.
Umweltschutz und Pläne zur Reduktion von Feinstaub ohne Einbezug von Feuerwerk werden zur Farce und unglaubwürdig.
Unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Problematik, die die „Feinstaubschleuder“ Feuerwerk mit sich bringt, muss Feuerwerk ganz klar verboten werden!
Autor: Susanne von Dach, www.stop-fireworks.org für CSN – Chemical Sensitivity Network, 29.12.2009






 Als Ende Oktober ein von Prof. Dr. Martin Pall geschriebenes
Als Ende Oktober ein von Prof. Dr. Martin Pall geschriebenes