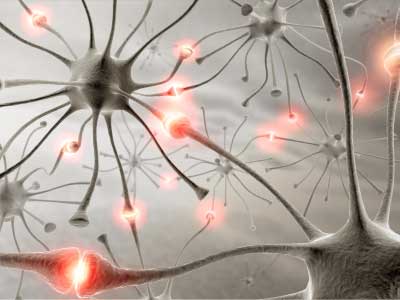
Eine spezielle Möglichkeit des Körpers, chemische Substanzen wahrzunehmen, ist die Chemorezeption.
Feron et. al. betonen in [1] die Bedeutung der Chemorezeption als dominantes Fenster des Gehirns zur Außenwelt sowie die der sich schnell entwickelnden nasalen Neurotoxikologie, die sich mit der Toxikologie der olfaktorischen und trigeminalen Nerven befasst. Bessere Einsichten in die Prozesse, die neurogener Inflammation zugrunde liegen, könnten ihrer Ansicht nach unser Wissen über die Ursachen der verschiedenen Chemical Sensitivity Syndrome verbessern.
Daher hier ein Beitrag zu dem in Darstellungen häufig vernachlässigten Thema der Chemorezeption. Es ist, neben dem Geschmacks- und dem Geruchssystem, das dritte chemosensorische System.
Ein Sinnesorgan, das auf chemische Stimuli reagiert, wurde erstmals 1912 von G.H. Parker beschrieben. Er nannte es „common chemical sense“, mittlerweile spricht man von „Chemesthesis“. Es handelt sich dabei nicht um ein unabhängiges sensorisches System, sondern besteht aus Nervenendungen, die eine Untergruppe der schmerz- und temperaturempfindlichen Nervenfasern bilden und sich durchgängig in der Haut und den Schleimhäuten befinden.
Wachposten für schädliche chemische Stimuli
Man kann das System als eine spezialisierte Komponente des schmerz- und temperaturempfindlichen somatosensorischen Nervensystems in Kopf und Nacken betrachten. Die gegenüber irritierenden Substanzen empfindlichen Schmerzrezeptoren des trigeminalen Systems helfen dabei, den Organismus auf potentiell schädliche chemische Stimuli aufmerksam zu machen, die eingeatmet wurden oder mit dem Gesicht in Kontakt gekommen sind.
Die peripheren Rezeptorneuronen und ihre zugehörigen Nervenendungen werden typischerweise erst durch relativ hohe Konzentrationen irritierender Chemikalien aktiviert, die in direkten Kontakt mit den Schleimhäuten des Kopfes, inklusive Mund, Nase und Augen kommen. Zu den Stimuli des trigeminalen Chemorezeptorsystems gehören Luftschadstoffe wie Schwefeldioxid, Ammoniak, Alkohol, Aldehyde, Essigsäure, Kohlendioxid, Menthol und Capsaicin (Pfeffer, Chili). Mit der Ausnahme von Capsaicin und sauren Stimuli, die beide kationselektive TRP-Kanäle (spezielle Rezeptoren auf den Nervenfasern) aktivieren, ist bisher wenig über die Reizübertragungsmechanismen für irritierende Substanzen und die zugehörige zentralnervöse Weiterverarbeitung bekannt. Alle genannten Substanzen können auch über das Geschmacks- und Geruchssystem wahrgenommen werden. Die Wahrnehmungsschwelle ist aber für die Rezeptoren des trigeminalen Chemorezeptorsystems deutlich höher.
Nerven reagieren auf chemische Stimuli
Beim Menschen ist das beste Beispiel für dieses System der chemosensitive Zweig des Trigeminusnervs (der 5. kraniale Nerv). Obwohl auch freie Nervenendungen von anderen kranialen und spinalen Nerven auf chemische Stimuli reagieren, ist der trigeminale Zweig der am besten erforschte. Er besteht aus polymodalen (durch verschiedene Arten von Reizen (z.B. Temperatur, Druck, chemische Reize) aktivierbaren) schmerzempfindlichen Neuronen und deren Axone (unmyelinierte C-Fasern) im Trigeminusnerv und in geringerem Maß aus entsprechenden Neuronen, deren Axone den Zungen-Rachen-Nerv bzw. den Vagusnerv entlanglaufen.
Die trigeminalen Nervenfasern finden sich innerhalb oder unter Epithelzell- (Deckgewebe-)schichten, wodurch sie für eventuelle Stimuli weniger gut zugänglich sind, als olfaktorische oder gustatorische (Geschmacks-) Rezeptoren. Zwischen den Epithelzellen reichen einige dieser Fasern fast bis zur Oberfläche und enden erst wenige Mikrometer unter den von engen Zellverbindungen gebildeten Grenzlinien zwischen den Zellwänden.
Um trigeminale Nervenendungen zu stimulieren, müssen die Stimuli daher erst entweder die Lipidphase (der fettfreundliche Teil) der Zellmembranen von Epithelzellen oder die wässrige Phase in den engen Zellzwischenräumen überwinden. Hydrophobe (Wasser abstoßende) Substanzen nutzen primär die Lipidphase, und Fettlöslichkeit ist daher ein wichtiger Faktor für die Effizienz hydrophober irritierender Substanzen. Allerdings beschränkt sich die Empfindlichkeit der Chemorezeption nicht auf hydrophobe Substanzen. Bisher ist nur ein kleiner Teil der rezeptiven Mechanismen bekannt.
Rezeptoren aktivieren Nerven
Das derzeit am besten verstandene Beispiel für die Aktivierung der trigeminalen Nerven ist der Capsaicinrezeptor. Capsaicin enthält einen vanilloidähnlichen Teil, weshalb der Rezeptor als Vanilloidrezeptor VR1 bekannt ist. Die Aktivierung von VR1 führt durch Depolarisierung des Axons zu einem kleinen Stromimpuls in der Nervenfaser, der dann ans Zentralnervensystem weitergeleitet wird. VR1 ist ein gutes Beispiel für einen polymodalen Rezeptor, der nicht nur durch Capsaicin, sondern auch durch Hitze und niedrige pH-Werte aktiviert werden kann. Ein weiterer polymodaler Rezeptor ist der Mentholrezeptor CMR1, der sowohl von Menthol als auch Kältereizen aktiviert wird. Ähnlich wie VR1 bei Stimulation durch Capsaicin zu einer „heißen“ Sensation führt, bewirkt Menthol bei CMR1 eine „kalte“ Empfindung. Der VR1 und der CMR1 Rezeptor sind strukturell mit der TRP (Transient Receptor Potential)-Rezeptorfamilie verwandt.
Spezielle Subtypen von Rezeptoren für körpereigene Substanzen wie ATP, Histamin, 5HT und Acetylcholin scheinen auch von den trigeminalen Neuronen gebildet zu werden. Im Falle von Acetylcholin scheint es mehr als einen Subtyp des nikotinischen Acetylcholinrezeptors (NnAChR) zu geben. Letzterer bewirkt auch die Empfindlichkeit gegenüber Nikotin.
Die Tatsache, dass viele irritierende Substanzen lipophil (fettlöslich) sind, legt die Vermutung nahe, dass es noch einen anderen Weg für die direkte Aktivierung trigeminaler Nervenendungen gibt, der nicht auf Rezeptoren angewiesen ist. Fettlösende Substanzen depolarisieren die Nervenendungen möglicherweise, indem sie die doppelte Lipid (Fett-) membran der Nervenendungen schädigen und so einen Ioneneintritt ermöglichen. Alternativ könnten auch diskrete Ionenkanäle entstehen.
Indirekte Stimulation reicht aus
Einige Stimuli benötigen keine direkte Interaktion mit einem Rezeptor, sondern stimulieren die Nervenendungen indirekt. Diese Stoffe müssen, nachdem sie in die Epithelzellschichten eingedrungen sind, erst verstoffwechselt werden und dabei eine aktive Substanz erzeugen. Das beste Beispiel hierfür ist Kohlendioxid.
Viele gut bekannte stechend wirkende Stoffe aktivieren die trigeminalen Nervenendungen vermutlich auf solch einem indirekten Weg, z.B. Aldehyde, Ketone, und Ester wie Benzaldehyd und Cyclohexanon sowie Äthylazetat.
Die trigeminalen Nervenendungen werden aber auch durch im Körper entstehende Substanzen aktiviert, die bei Gewebeschädigungen freigesetzt werden. Auch entzündliche Prozesse können dazu beitragen.
Die meisten chemosensorischen Informationen vom Gesicht, der Kopfhaut, der Hornhaut des Auges und der Schleimhäute des Mundes und der Nase werden über die drei wesentlichen sensorischen Zweige der Trigeminusnervs übertragen: den ophtalmischen, maxillaren und mandibularen Zweig ( vgl. nochmals #) Das zentrale Ziel dieser afferenten (zum Hirn hinführenden) Nerven ist der Trigeminus Nukleus im Rückenmark, der die Informationen über einen Nukleus des Thalamus an das Großhirn weiterleitet. Durch Exposition gegenüber irritierenden Substanzen wird eine ganze Anzahl von physiologischen Reaktionen ausgelöst, die vom trigeminalen Chemorezeptorsystem reguliert werden. Dazu gehören erhöhter Speichelfluss, Gefäßerweiterung, Tränenfluss, nasale Sekretion, Schwitzen, Verringerung der Atemfrequenz und Verengung der Bronchien. Einige der ausgelösten Schutzreflexe, die dazu dienen, den Körper aus der vermeintlichen Gefahrenzone zu bringen, gehören zu den stärksten, die wir haben.
Während einige der vorgenannten physiologischen Reaktionen von der trigeminalen Aktivierung autonomer Nervenfasern über das ZNS herrühren, gibt es daneben auch noch den Vorgang des Axonreflexes. Eine Untergruppe der capsaicinsensitiven trigeminalen Fasern geben bei Stimulation das vasoaktive (die Gefäßweite beeinflussende) Neuropeptid Substanz P (SP) und CGRP (calcitonin gene related protein) ab. Außerdem wird ein Signal in Richtung des trigeminalen Ganglions und des ZNS gesendet. Beim Axonreflex kann dieses Signal auch zu einer in die andere Richtung wirkenden Erregung anderer Zweige des Axons führen, was dann zur Freisetzung von Neuropeptiden durch alle Zweige des betreffenden Neurons führt. Dies hat weiter Gefäßerweiterung und das Auslaufen von Plasma zur Folge, womit gewebsschützende Effekte verbunden sind.
Trigeminale Stimulation beeinträchtigt Geschmackssystem
Es gibt Hinweise darauf, dass orale trigeminale Stimulation die Funktion des Geschmackssystems modifiziert (vgl. die Geschmacksbeeinträchtigung durch Cyclohexanon (s.o.) die in dem kürzlich erschienenen Blogbeitrag beschrieben wird. Der Hauptautor hatte das selbst erlebt und sagte: „Ich bin ein Schokoladenjunkie und nach meiner Bypassoperation schmeckte alles fürchterlich und Schokolade schmeckte monatelang wie Holzkohle.“ Ähnlich wurde gezeigt, dass die lokale Freisetzung von Neuropeptiden nach nasaler Stimulation die Funktion des Geruchssystems verändert. Trigeminale Stimulation vermindert die Empfindlichkeit des Geruchssinns. Weiter wird auch die Funktion des Riechkolbens beeinflusst. Substanz P und CGRP enthaltende Nervenendungen innervieren auch den Riechkolben bis hin zur Glomerularschicht. Einige dieser Nervenfasern sind Seitenzweige von Fasern, die man auch in der Nasenschleimhaut findet. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Modulation des Riechkolbens durch trigeminale Stimulation über den Axonreflex erfolgt, ohne eine Weiterschaltung durch die trigeminalen sensorischen Nukei im Hirnstamm zu benötigen.
Vor kurzem wurden spezielle chemorezeptive Zellen bei Mäusen gefunden, wodurch sich das Spektrum der chemorezeptiven Mechanismen weitert vergrößert hat. Darüber werde ich kurz in einem späteren Beitrag berichten.
Autor: Karlheinz für CSN – Chemical Sensitivity Network, 11. Mai 2009
Literatur:
Neuroscience, Fourth Edition, Edited by Dale Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, William C. Hall, Anthony-Samuel LaMantia, James O. McNamara, and Leonard E. White, Sinauer 2008 (Die komplette zweite Auflage eines Buchs über Neuroscience gibt es unter http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?call=bv.View..ShowTOC&rid=neurosci.TOC&depth=10 . Um einzelne Themen aufzurufen Stichwort bei der Suchfunktion eingeben. Unter http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=books findet man weitere gehaltvolle Bücher, die man durchsuchen kann.)
Alimohammadi Hessamedin, Wayne L. Silver, Chemesthesis: Hot and Cold Mechanisms, Chemosense, Vol. 4 No.2 March 2002.
[1] Feron VJ, Arts JH, Kuper CF, Slootweg PJ, Woutersen RA., Health risks associated with inhaled nasal toxicants. Crit Rev Toxicol. 2001 May;31(3):313-47. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11405443
Links: a) http://www.csn-deutschland.de/blog/?s=TRP , b) in CSN Suchfunktion „trigeminal“ eingeben http://www.csn-deutschland.de.


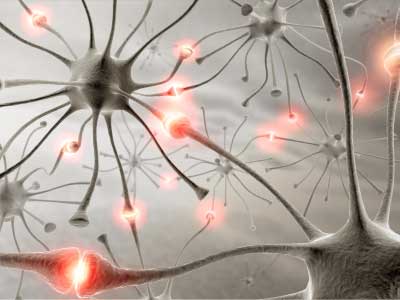


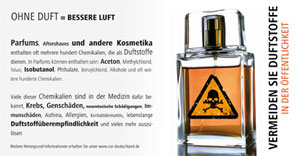
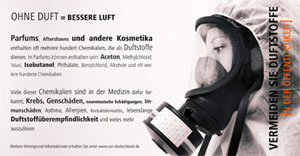
 In Ohio haben kürzlich zwei Senatoren eine Gesetzesvorlage verfasst, um den Monat Mai permanent zum „Multiple Chemical Sensitivity Aufklärungsmonat“ zu erklären. Bisher musste jedes Jahr neu entschieden werden, ob im Mai mittels einer Proklamation besondere Aufklärung darüber stattfindet, wie Spuren von Alltagschemikalien manche Menschen gesundheitlich so stark beeinträchtigen, dass sie nicht mehr am Allgemein- und Berufsleben teilnehmen können. Nun soll jedes Jahr im Mai ohne weitere Bürokratie in der Bevölkerung Bewusstsein für Menschen mit Umweltkrankheiten und MCS geschaffen werden.
In Ohio haben kürzlich zwei Senatoren eine Gesetzesvorlage verfasst, um den Monat Mai permanent zum „Multiple Chemical Sensitivity Aufklärungsmonat“ zu erklären. Bisher musste jedes Jahr neu entschieden werden, ob im Mai mittels einer Proklamation besondere Aufklärung darüber stattfindet, wie Spuren von Alltagschemikalien manche Menschen gesundheitlich so stark beeinträchtigen, dass sie nicht mehr am Allgemein- und Berufsleben teilnehmen können. Nun soll jedes Jahr im Mai ohne weitere Bürokratie in der Bevölkerung Bewusstsein für Menschen mit Umweltkrankheiten und MCS geschaffen werden.  Trotz hohem Hygienestandard sind auch in Deutschland Kopfläuse wieder auf dem Vormarsch. In Schulen, Kindergärten und dort wo viele Menschen auf engstem Raum zusammenkommen, kann Gefahr bestehen, sich zu infizieren. Fängt es an zu jucken, ist mancher schnell in Panik und greift zu chemischen Mitteln zur Bekämpfung der Läuse. Die zur Wahl stehenden Präparate enthalten u. a. Permethrin, Pyrethrum, Allethrin oder Lindan. Alle diese Insektizide schädigen die Gesundheit. Deshalb raten Ministerien, Länder-, Bundesbehörden und Mediziner besonders Schwangeren, Stillenden und Personen mit MCS – Multiple Chemical Sensitivity (Chemikalien-Sensitivität) davon ab, diese gefährlichen, neurotoxischen Insektizide zu verwenden. (1-9)
Trotz hohem Hygienestandard sind auch in Deutschland Kopfläuse wieder auf dem Vormarsch. In Schulen, Kindergärten und dort wo viele Menschen auf engstem Raum zusammenkommen, kann Gefahr bestehen, sich zu infizieren. Fängt es an zu jucken, ist mancher schnell in Panik und greift zu chemischen Mitteln zur Bekämpfung der Läuse. Die zur Wahl stehenden Präparate enthalten u. a. Permethrin, Pyrethrum, Allethrin oder Lindan. Alle diese Insektizide schädigen die Gesundheit. Deshalb raten Ministerien, Länder-, Bundesbehörden und Mediziner besonders Schwangeren, Stillenden und Personen mit MCS – Multiple Chemical Sensitivity (Chemikalien-Sensitivität) davon ab, diese gefährlichen, neurotoxischen Insektizide zu verwenden. (1-9)


 Researchers at the Johns Hopkins University School of Medicine have found that a chemical commonly used in the production of such medical plastic devices as intravenous (IV) bags and catheters can impair heart function in rats. Reporting online this week in the American Journal of Physiology, these new findings suggest a possible new reason for some of the common side effects – loss of taste, short term memory loss–of medical procedures that require blood to be circulated through plastic tubing outside the body, such as heart bypass surgery or kidney dialysis. These new findings also have strong implications for the future of medical plastics manufacturing.
Researchers at the Johns Hopkins University School of Medicine have found that a chemical commonly used in the production of such medical plastic devices as intravenous (IV) bags and catheters can impair heart function in rats. Reporting online this week in the American Journal of Physiology, these new findings suggest a possible new reason for some of the common side effects – loss of taste, short term memory loss–of medical procedures that require blood to be circulated through plastic tubing outside the body, such as heart bypass surgery or kidney dialysis. These new findings also have strong implications for the future of medical plastics manufacturing.