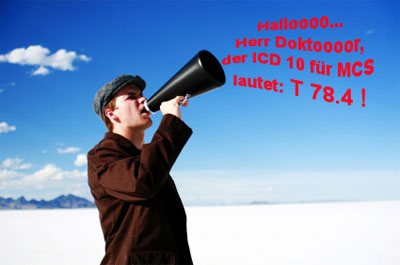Prof. Martin Pall hielt den nachfolgend in Kurzfassung wiedergegebenen Vortrag am 3. Dezember an der Universität Bern in der Schweiz und einen Tag später in Zürich. Weitere Stationen der europäischen Vortragsreise von Prof. Pall waren u.a. in Paris, Rom und Würzburg, sowie abschließend im Europaparlament in Strassburg.
Die Präsentation zum Vortrag kann hier im Original angeschaut werden: Explaining „unexplained Illnesses“ (Das Laden der Datei dauert eine Weile)
Die nachfolgend angegebenen Seitenzahlen im Text beziehen sich auf die Originalpräsentation. Zum besseren Verständnis ist es ratsam, sich den Artikel auszudrucken und synchron dazu die Präsentation von Prof. Pall anzuschauen.
MCS – Toxikologische Entstehungsmechanismen, therapeutische Annäherungsversuche
Prof. Pall beginnt mit der Feststellung, dass Chronic Fatigue Syndrome (CFS), Fibromyalgie (FM), Multiple Chemical Sensitivity (MCS) und, in einigen Fällen, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) vielfältige Überschneidungen und möglicherweise eine gemeinsame Krankheitsätiologie (Ursache) haben, was bereits von vielen Forschergruppen vermutet und vorgeschlagen wurde. (S.2-5)
Heilung ist selten
Was die Prognose der Erkrankungen betrifft, wird bezüglich CFS und FM in der wissenschaftlichen Literatur zwar von vollständiger Heilung berichtet, sie tritt allerdings selten auf. Nur etwa 10% der CFS- und FM-Patienten werden wieder völlig gesund, und dies dauert in der Regel mehrere Jahre. Bei MCS tritt völlige Heilung, wenn überhaupt, sehr selten ein. MCS-Erkrankte erfahren aber eine Besserung der Krankheitssymptome, falls sie die Exposition gegenüber den Chemikaliengruppen vermeiden können, die die Krankheitssymptome auslösen. (S.6)
Die Skeptiker irren sich
Prof. Pall richtet im Folgenden seinen Blick speziell auf MCS und da auf die Frage: Wie können diese so vielfältigen chemischen Substanzen, die sowohl in die Entstehung der Erkrankung MCS verwickelt sind als auch später bei bereits an MCS Erkrankten als Auslöser fungieren, dieselbe Reaktion im Körper auslösen? Manche MCS-Skeptiker, einschließlich Ronald Gots, stellten die Existenz einer gleichen Wirkung so vielfältiger Chemikalien in Abrede. Die Skeptiker irrten sich, sagt Prof. Pall. Er wird den gemeinsamen Wirkungsweg hier aufzeigen. (S.7)
An Auslösern für MCS nennt Prof. Pall folgende Chemikalien (S.8):
– Organische Lösungsmittel und artverwandte Verbindungen
– Organophosphat- und Organocarbamat-Pestizide und -Insektizide
– Organochlorpestizide und Organochlorinsektizide
– Pyrethroidhaltige Pestizide und Insektizide
aber auch:
– Schwefelwasserstoff
– Kohlenmonoxid
– Quecksilber
Auf welchem biochemischen / physiologischen Weg diese Chemikalien bei MCS wirken, zeigt die Grafik auf S. 9:
Organische Lösungsmittel … Vanilloid-Rezeptor … NMDA-Rezeptor-Aktivität … usw.
(Genaueres in der Grafik selbst)
Aus Tierversuchen ist bekannt…
Für diese vier Chemikaliengruppen (die organischen Lösungsmittel und die drei Gruppen von Pestiziden/Insektiziden) weiß man aus Tierversuchen:
Ihre Toxizität im Körper kann deutlich herabgesetzt werden durch Behandlung mit einem NMDA-Antagonisten. Das zeigt zum einen, dass diese Chemikalien die NMDA-Aktivität verstärkten, und zum anderen, dass diese erhöhte Aktivität eine sehr wichtige Rolle spielt hinsichtlich der Erzeugung der toxischen Reaktionen im Körper. (S.10)
Für die drei anderen MCS-auslösenden Chemikalien (Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid, Quecksilber) beschreibt Prof. Pall ähnliche toxikologische Eigenschaften (siehe S.11).
Auf Seite 12 werden sechs weitere Beobachtungen genannt, die auf die wichtige Rolle von NMDA bei MCS hinweisen. Prof. Pall bezeichnet sie als zwingenden Beweis für eine gemeinsame toxikologische Reaktion (siehe S.12).
Tabelle 1 auf S.13 : Übersicht über Genpolymorphismen (aus 3 Studien, 1999-2007)
MCS ist keine Reaktion auf Gerüche
Mit Nachdruck weist Prof. Pall darauf hin, dass die Rezeptoren für diese verschiedenen, oben genannten Chemikalien nicht die Geruchsrezeptoren sind. Es wurde oft behauptet, dass MCS eine Reaktion auf Gerüche sei, aber das ist nicht der Fall! Selbst wenn bei MCS-Erkrankten die Nasenwege blockiert werden, reagieren sie nach wie vor auf Chemikalien. Bei einigen MCS-Patienten fehlt der Geruchssinn vollständig (Anosmie), und dennoch reagieren diese Menschen. Prof. Pall will nicht sagen, dass das Geruchssystem niemals mit einbezogen ist in das MCS-Geschehen, aber er sagt, dass der tatsächlich entscheidende Wirkungsmechanismus nicht über Geruch, Geruchsrezeptoren oder Geruchssinn geht. (S.14)
Chemikalien aktivieren Rezeptor
Wichtig hinsichtlich der Reaktion auf Chemikalien ist also, wie Prof. Pall bis hierher dargelegt hat, dass die genannten Chemikalien den NMDA-Rezeptor aktivieren. Im Folgenden (S.15-23) beschreibt Prof. Pall nun den weiteren Reaktionsweg, das Einströmen von Calcium in die Zellen, die Bildung von Peroxynitrit und schließlich den Teufelskreis Stickstoffmonoxid (NO) – Peroxynitrit (NO3, Nitratanion) und seine Rolle im MCS-Geschehen. Dabei weist er auch auf Stoffwechselstörungen der Mitochondrien und die Bedeutung von Tetrahydrobiopterin hin, das selbst wieder in der Lage ist, einen weiteren Teufelskreis in Gang zu halten. (S.19)
Auslöser und auslösende Faktoren hinsichtlich NO-NO3-Teufelskreis nennt Prof. Pall auf S.17.
Fünf wichtige Punkte zu dem Geschehen führt Prof. Pall auf Seite 21 auf:
- Befristete Auslöser lösen diese Multisystem-Erkrankungen aus, indem sie Stickstoffmonoxid oder andere Elemente des Zyklus stimulieren
- Dieses Ansteigen an Stickstoffmonoxid und Peroxynitrit setzt den NO/ONOO- Zyklus in Gang, der dann diese chronischen Erkrankungen verursacht.
- Die Symptome und Anzeichen dieser Erkrankungen werden verursacht durch Erhöhungen an Bestandteilen des NO/ONOO- Zyklus, Stickstoffmonoxid, Hyperoxid, Peroxynitrit, NF-kappaB, oxidativem Stress, Vanilloid-Aktivität, NMDA-Aktivität etc.
- Die diesem Kreislauf zu Grunde liegende Biochemie findet auf regionaler Ebene statt, da Stickstoffmonoxid, Hyperoxid und Peroxynitrit begrenzte Halbwertszeiten in biologischen Geweben haben und da der positive Rückkopplungsmechanismus, der diesen Kreislauf am Laufen erhält, auf zellulärer Ebene stattfindet.
- Die Therapie sollte primär darauf abzielen, Teile des NO/ONOO- Zyklus nach unten zu regulieren, und weniger darauf, Erleichterung im Bereich der Symptome zu verschaffen.(S.21)
Symptome und deren Ursachen
In seinem Buch beschrieb Prof. Pall für 16 Symptome und Anzeichen, die häufig bei MCS, CFS, FM und PTSD vorkommen, den möglichen Wirkungsmechanismus. Auf den Seiten 25 und 26 seines Vortrags gibt er einen kurzgefassten Überblick darüber. So ist z.B. das Symptom „Lern- und Gedächtnisschwierigkeiten“ erklärbar als eine Folge von erhöhtem Stickstoffmonoxid im Gehirn und einem erniedrigten Energiestoffwechsel des Gehirns. (Weitere Symptome und deren Ursachen siehe S.25,26)
1000-mal empfindlicher als Gesunde
Im folgenden Teil des Vortrags wird Prof. Pall sich nicht mehr mit allen 4 Erkrankungen beschäftigen, sondern sich auf die Frage konzentrieren, über welche Wirkungswege es zu den spezifischen Veränderungen bei MCS kommt. Dabei sollen zum Beispiel diese Fragen geklärt werden:
- Wie können Menschen mit MCS so hoch empfindlich sein gegenüber einer so enormen Vielzahl an Chemikalien, etwa 1000-mal empfindlicher als Gesunde?
- Und wie kann frühere Chemikalienexposition diese derart hochgradige Sensitivität verursachen? (S.27)
Vergleich NO/ONOO-Modell – neurale Sensibilisierung
Einen sehr großen Durchbruch in Hinblick auf das Verstehen von MCS erhielt man, als Prof. Pall das NO/ONOO-Modell mit dem Modell der neuralen (neuronalen) Sensibilisierung, das Dr. Iris Bell entwickelt hatte, verglich. Dr. Bell erörterte, dass der Hauptmechanismus bei MCS eine neurale (neuronale) Sensibilisierung im Bereich des Hippocampus sei. Das ist die Gegend, die auch eine Schlüsselfunktion für das Lernen und das Gedächtnis innehat. Dr. Bell entwickelte die Vorstellung, dass die Synapsen im Gehirn, also die Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, über die die Reizleitung vermittelt wird, sowohl empfänglicher werden für Reize als auch stärker auf ankommende Reize reagieren, und das als Folge auf die Exposition gegenüber Chemikalien. Die Grundidee bei dieser neuralen Sensibilisierung ist, dass dieser Prozess der neuralen Sensibilisierung, die sich hier im Hippocampus ganz selektiv auswirkt auf Lernen und Gedächtnisleistungen, bei MCS vermutlich sehr stark aktiviert ist. (S.28)
Der Hauptmechanismus neuraler Sensibilisierung ist bekannt als Langzeit-Potenzierung (LTP). LTP führt bekanntermaßen zu erhöhter NMDA-Rezeptor-Aktivität, erhöhtem intrazellulären Calcium, Stickstoffmonoxid und auch Hyperoxid. Man erkennt also sofort wichtige Verbindungen zwischen dem Mechanismus des NO/ONOO-Kreislaufs und dem Mechanismus der neuralen Sensibilisierung von Dr. Bell. Wenn man es also mit Chemikalien zu tun hat, die eine erhöhte NMDA-Aktivität auslösen, kann man ersehen, auf welche Weise sie den LTP-Mechanismus in hohem Maß stimulieren könnten. Etliche Faktoren des NO/ONOO-Zyklus spielen eine Rolle bei der Langzeit-Potenzierung. Zu diesen Faktoren gehören auch erhöhte NMDA-Rezeptor-Aktivität, erhöhtes intrazelluläres Calcium, Stickstoffmonoxid und -hyperoxid. (S.29)
Eine stark vereinfachte Darstellung einiger dieser Vorgänge ist auf S.30 zu sehen.
(Erweiternde Anmerkung: Zu neuraler / neuronaler Sensibilisierung schreibt Prof. Pall auch in diesem Artikel: Neural Sensitization
Sieben Wirkungsmechanismen können eine Rolle spielen
Es gibt 7 Wirkungsmechanismen, die für das Entstehen der Chemikaliensensitivität bei MCS eine wichtige Rolle spielen können:
- Die Wirkung von Chemikalien verstärkt die NMDA-Aktivität in Gehirnregionen, in denen der NO/ONOO-Zyklus bereits verstärkt abläuft, was wiederum durch vorausgehende Exposition gegenüber Chemikalien hervorgerufen worden war.
- Stickstoffmonoxid wirkt als „rückläufiger Botenstoff“ und verstärkt dadurch die NMDA-Stimulation.
- NO3, das Nitratanion, bewirkt eine Verminderung des Energiestoffwechsels, was zu einer erhöhten NMDA-Sensitivität gegenüber Stimulierung führt.
- NO3 bewirkt eine Verminderung des Energiestoffwechsels, der Glutamat-Transport sinkt, die NMDA-Stimulierung nimmt dadurch zu.
Stickstoffmonoxid inhibiert den Cytochrom P450-abhängigen Um- und Abbau von Chemikalien und führt dadurch zu einer vermehrten Ansammlung von Chemikalien.
- NO3 schädigt die Blut-Hirn-Schranke und führt dadurch zu einem vermehrten Einströmen von Chemikalien ins Gehirn.
- Oxidationsmittel und Hyperoxide führen zu erhöhter Vanilloid-Aktivität und damit zu erhöhter Sensibilität gegenüber organischen Lösungsmitteln. (S.31)
Neurogene Entzündung und Mastzellaktivierung
Dr. William Meggs, ein medizinischer Forscher an der medizinischen Fakultät in North Carolina, beschrieb Studien, die er und andere durchgeführt hatten, in denen sich Chemikaliensensitivität in anderen Regionen des Körpers zeigte. Diese periphere (sich außerhalb des Gehirns zeigende) Sensitivität tritt in den unteren Lungenbereichen auf, im oberen Respirationstrakt, auf der Haut und im Gastrointestinaltrakt. Diese Sensitivitätsreaktionen werden ausgelöst durch vorausgehende Chemikalienexposition, und die auslösenden Chemikalien sind denen ähnlich, die bei der zentralen (im Gehirn auftretenden) Sensitivität ursächlich beteiligt sind. Daraus lässt sich schließen, dass ähnliche Reaktionsmechanismen ablaufen. Bei einigen MCS-Patienten sind alle diese peripheren Regionen vom Krankheitsgeschehen betroffen, bei anderen Patienten fehlen periphere Reaktionen völlig.
Meggs und auch Heuser berichteten über zwei zusätzliche Mechanismen, die ursächlich an diesen peripheren Sensitivitätsreaktionen beteiligt sind: neurogene Entzündung und Mastzellaktivierung. Beide Mechanismen sind kompatibel mit dem Mechanismus des NO/ONOO- Kreislaufs. (Man kann sie unter einen Hut bringen.) (S.32)
Messbare Veränderungen bei Chemikaliensensiblen
Gibt es irgendwelche speziellen Eigenheiten dieser Erkrankung, die man messen kann, die MCS-Erkrankte deutlich von anderen unterscheiden?
Bell (in Arizona) berichtete über Veränderungen in EEG-Mustern als Reaktion auf Chemikalienexposition im Niedrigdosisbereich. Kimata (in Japan) berichtete über Veränderungen sowohl der NGF-Levels (NGF, nerve growth factor, Nervenwachstumsfaktor) als auch der Histamin-Levels, die ebenfalls für MCS spezifisch sein dürften.
Millqvist (in Schweden) berichtete über erhöhte Hustenreaktion in Verbindung mit Capsaicin bei MCS-Patienten. Shinohara (in Japan) berichtete Hypersensitivitätsreaktionen auf Chemikalien und Joffres (in Canada) Veränderungen in der Hautleitfähigkeit nach niedriger Chemikalienexposition. Es gibt eine Anzahl Studien mit Messungen der Nasenspülflüssigkeit (NAL), die zeigen, dass chemisch sensitive Personen mit erhöhten Entzündungsmarkern auf Chemikalienexposition reagieren.
Jede einzelne dieser Veränderungen kann eine spezifische Veränderung bei MCS-Erkrankten sein und jede einzelne dieser Veränderungen lässt sich mit dem Modell des NO/ONOO- Zyklus´ erklären. Diese Veränderungen sollten als mögliche „spezifische Biomarker“ für MCS betrachtet werden. (S.33)
Therapiemaßnahmen, Fragen und Antworten
Im weiteren Vortrag beschäftigt sich Prof. Pall mit Maßnahmen zur Therapie (S.34-41) und hebt nochmals die Bedeutung des NO-Peroxynitrit-Zyklus´ hervor (S.42- 45). Er streift die Themen neuronale Entzündung und Mastzellaktivierung bei peripheren MCS-Symptomen, sowie mögliche Veränderungen im Porphyrinstoffwechsel bei MCS -Erkrankten (S.46).
Die Rolle der Mykotoxine beim Entstehen von MCS wurde bislang nicht geklärt. Da bekannt ist, dass einige Mykotoxine den TRPV1 – Rezeptor stimulieren, schlugen Anderson und Prof. Pall diesen Weg als möglichen Reaktionsweg der Pilze in diesem Krankheitsgeschehen vor.
Der Vanilloid-Rezeptor erklärt auch das Phänomen des Überdeckens / Maskierens bei MCS. (S.47)
Fragen und Antworten von S. 45:
- Wie bringen die vier Gruppen von Chemikalien, die verwickelt sind in MCS, diese Erkrankungen in Gang, und wie verstärken sie die Sensitivitäts-Symptome?
Jede der vier Gruppen agiert über bekannte Wirkungswege und erzeugt dabei erhöhte NMDA-Aktivität, die daraufhin wiederum vermehrt Stickstoffmonoxid und Peroxynitrit bildet.
- Warum reagieren MCS-Erkrankte so ungemein sensibel auf Chemikalien, etwa 1000-mal empfindlicher als Gesunde?
Weil sechs verschiedene Mechanismen wirken, fünf davon betreffen Stickstoffmonoxid oder Peroxynitrit, und der sechste betrifft Hyperoxid.
Es ist die Kombination dieser Mechanismen, die zusammenwirken und sich verstärken. Dies führt zu diesem extrem hohen Niveau der Sensitivität.
Einige andere oft gestellten Fragen werden auf S.48 beantwortet und weitere Erkrankungen in Zusammenhang mit dem NO-Peroxynitrit-Zyklus kurz betrachtet (S.50-53).
Ganz herzlicher Dank für die Übersetzung und Zusammenfassung geht an Annamaria!