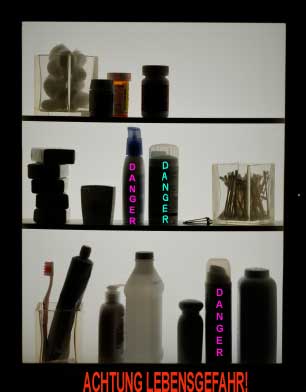MCS – Multiple Chemical Sensitivity tritt auch in Australien häufig auf
Menschen, die unter MCS – Multiple Chemical Sensitivity (ICD-10 GM T78.4) leiden, gibt es mittlerweile nahezu überall, sogar am anderen Ende der Welt, in Australien. 24,6% der in der australischen Region New South Wales lebenden Erwachsenen fühlen sich einer Umfrage nach regelmäßig durch Ausdünstungen von Chemikalien und deren Gerüche schlecht. Das ist fast ein Viertel der Bevölkerung dieser Region, die auf einem Kontinent liegt, der über sehr viel saubere Luft verfügt und dünn besiedelt ist.
Umfrage über Chemical Sensitivity in Australien
Auch in Australien, nach Alaska der bevölkerungsärmste Kontinent auf unserem Planeten, gibt es Menschen, die unter Chemical Sensitivity leiden. Australien hat Wüsten, Halbwüsten, Steppen, Urwald und lange Küstenregionen, die allesamt dünn besiedelt sind (2,7 Menschen pro Quadratkilometer). Die meisten Menschen leben in der Region New South Wales (NSW), die sich im Südosten des Kontinents befindet, dort, wo die großen Städte Sydney, Newcastle und die Hauptstadt Canberra liegen. Hier liegt die Bevölkerungsdichte bei 8,43 Einwohnern pro Quadratkilometer, wobei die meisten Menschen in den Städten in der Küstenregion leben.
In NSW wurde die Bevölkerung wiederholt nach ihrem Gesundheitszustand befragt. Jeweils eine Person eines Haushaltes, die über 16 Jahre war, durfte an der Befragung mittels des New South Wales Adult Health Survey teilnehmen. Eine epidemiologische Studie zu MCS gab es zuvor noch nicht in Australien.
MCS Diagnosekriterien American Consensus
Der Definition des Begriffes MCS lag bei der australischen Umfrage die nachfolgende Fall – und Diagnosedefinition, der American Consensus zugrunde:
- Die Symptome sind mit (wiederholter chemischer) Exposition reproduzierbar
- Der Zustand ist chronisch
- Minimale Expositionen (niedriger als vormals oder allgemein toleriert) resultieren in Manifestation des Syndroms
- Die Symptome verbessern sich oder verschwinden, wenn der Auslöser entfernt ist
- Reaktionen entstehen auch gegenüber multiplen nicht chemischen Substanzen
- Die Symptome involvieren mehrere Organsysteme. (1999 ergänzt)
Asthma, Allergien, Migräne, Chronische Müdigkeit Syndrome und Fibromyalgie stellen keine Ausschlussdiagnose für MCS dar.
Fragen nach der Häufigkeit von MCS im New South Wales
Die Umfrage nach dem Gesundheitszustand und der Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem im New South Wales Adult Health Survey stellte 12.622 Erwachsenen unter anderem auch die beiden nachfolgenden Fragen bezüglich Chemikaliensensitivität:
Lassen chemische Ausdünstungen oder Gerüche Sie sich regelmäßig unwohl fühlen?
Wurde bei Ihnen jemals Chemikaliensensitivität diagnostiziert?
Diese beiden Fragen brachten zutage, dass rund ein Viertel der Bevölkerung in der Region New South Wales unter Chemikaliensensitivität leidet (24,6%). Im Vergleich berichteten nur 6% der Befragten, das sie unter Diabetes leiden, 10,6% gaben an, Asthma zu haben und 12% hatten hohe bis sehr hohe psychische Probleme. 81% der Befragten gaben an, in einem rauchfreien Haushalt zu leben. Hieraus ergibt sich, dass MCS relativ gesehen ein recht weit verbreitetes Beschwerdebild ist.
Frauen häufiger von MCS betroffen als Männer
Der Gesundheitsfragebogen fand heraus, dass, wie auch in anderen Teilen der Welt beobachtet, mehr Frauen (28,9%) als Männer (20,1%) unter MCS leiden. Sehr interessant war, dass im Vergleich gesehen ein signifikant geringerer Anteil von Frauen über 75 Jahren (16%) im Vergleich zu jüngeren Fragen angab, unter einer Sensitivität gegenüber Chemikalien zu leiden.
Bei den Männern sah es ähnlich aus, auch hier klagten ältere Männer über 65 Jahre seltener über Reaktionen auf Chemikalien als Jüngere (11,5% / 15,4%) im Vergleich zur gesamten männlichen Bevölkerung.
Ob Stadt- oder Landleben spielt keine große Rolle
Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass ein Leben in einer Stadt eher zu Chemikaliensensitivität führt als das Leben auf dem Land in Australien. Der Fragebogen zum Gesundheitszustand in NSW stellte hingegen fest, dass es bei der Entwicklung von MCS kaum einen Unterschied ausmacht, ob man in der Stadt oder auf dem Land lebt. Unter den Befragten mit MCS lebten 23,7% in ländlicher Region und 24,8% in der Stadt. Eine Ausnahme bildeten Befragte der nördlichen Sydney Region, sie litten prozentual seltener unter MCS als Bewohner anderer Regionen (19,6%). Ein sozioökonomischer Aspekt bei war bei den MCS-Erkrankten hingegen nicht festzustellen. Bei Arm und Reich lag der Prozentsatz ungefähr gleich.
MCS wird von australischen Ärzten bisher noch selten diagnostiziert
In Australien ist medizinische Versorgung oft nicht gleich um die Ecke verfügbar, außer natürlich in den Städten. Dieser Aspekt und der Umstand, dass genau wie anderorts auf der Welt nicht jeder Arzt MCS diagnostizieren kann und viele Mediziner sogar überhaupt noch nie von der Erkrankung gehört haben, dürfte dazu geführt haben, dass in NSW nur 2,9% der Befragten die Diagnose MCS durch einen Arzt erhalten hatten. Auffallend war weiterhin, dass der Prozentsatz der jüngeren Bevölkerungsschicht mit Diagnose MCS wesentlich geringer ausfiel, als im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung (16-24 Jahre / 1,5%). Der Unterschied zwischen der Häufigkeit der Diagnosestellung von MCS in der Stadt und auf dem Land war hingegen nur unwesentlich.
Autor:
Silvia K. Müller, CSN – Chemical Sensitivity Network, 07.12.2008
Literatur:
NSW Health Survey 1997, 1998 und 2002 (HOIST). Centre for Epidemiology and Research, NSW Department of Health, Dec. 2003
Report of the New South Wales Health Survey Program, Chemical sensitivity