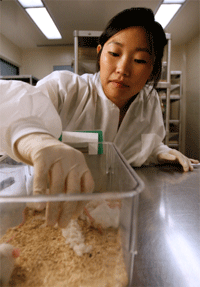Jugendliche häufig an Chemikaliensensitivität erkrankt
Chemikaliensensitivität bei Kindern und Jugendlichen ist ein Thema, das kaum Erwähnung findet in der Öffentlichkeit. Doch sie existieren, die Kinder und Jugendlichen, die auf Alltagschemikalien wie Parfum, Lacke, Zeitungen, Abgase, etc. mit zum Teil schweren körperlichen Symptomen reagieren. Schwedische Wissenschaftler fanden in einer aktuellen Studie heraus, dass Chemikaliensensitivität bei Jugendlichen mit 15,6% fast genauso häufig wie bei Erwachsenen auftritt. Die Folgen sind weitreichend, denn in Schulen und beim Start ins Berufsleben wird kaum Rücksicht auf sie genommen. Zusätzlich sind Kinder und Jugendliche durch ihre Krankheit zwangsläufig sozial ausgegrenzt.
Jugendliche kooperativ gegenüber Wissenschaftlern
Die schwedische Wissenschaftlerin Prof. Eva Millqvist beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema Chemikaliensensitivität. Sie konnte in mehreren Studien belegen, dass die Erkrankten körperlich auf minimale Konzentrationen von Alltagschemikalien, wie beispielsweise Parfum, reagieren. Aktuell untersuchte Millqvist und ihr Team eine nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Gruppe von 401 Teenagern. Sie schickten den Jugendlichen Fragebögen zu und luden anschließend eine Teilgruppe von 85 Teenagern zu einem speziellen Capsaicin Inhalationstest ein. Die Teilnahmebereitschaft der jungen Leute war hoch, 81,3% beantworteten die Fragen bezüglich Sensibilität gegenüber Chemikalien und Lärm, sowie Ängsten und Depressionen.
Chemikaliensensitivität erschreckend häufig bei Jugendlichen
Die von den Wissenschaftlern ermittelte Häufigkeit für eine Chemikaliensensitivität bei Jugendlichen lag bei 15,6%. Eine hohe Zahl, die Konsequenzen nach sich ziehen müsste, denn bisher wird in europäischen Ländern an Schulen kaum ein Augenmerk auf chemikaliensensible Schüler gerichtet oder gar Rücksicht auf sie genommen. In den USA und Kanada hingegen ist man sich der Existenz dieser Problematik durchaus bewusst, und es gibt zahlreiche Schulen und Universitäten, an denen ein striktes Duftstoffverbot besteht und die auf Chemikalien verzichten, wo immer es möglich ist. Sind bei Renovierungsarbeiten doch ausnahmsweise chemikalienhaltige Materialien erforderlich, geben solche Bildungseinrichtungen frühzeitig Warnungen heraus oder sperren die betreffenden Areale. Solches Entgegenkommen und ein chemikalienfreies Umfeld ermöglicht es den kranken jungen Menschen, ihre Intelligenz zu entfalten, in die Gemeinschaft integriert zu sein und einer eigenständigen Zukunft entgegen gehen zu können.
Psyche nebensächlich beteiligt
Millqvist und ihr Team gingen auch der Frage nach, ob die Psyche eine Rolle bei den Chemikaliensensiblen spielt, fanden jedoch nur bei 3,7% der Jugendlichen affektive und Verhaltensänderungen. Wobei nicht beurteilt werden kann, ob die psychische Komponente nicht als Resultat der weitreichenden Restriktionen, denen diese jungen Menschen durch ihre limitierende Erkrankung zwangsläufig unterworfen sind, gelitten hat. Denn statt eine unbeschwerte Jugendzeit unter Gleichaltrigen, Selbstfindung und Ausloten von persönlicher Freiheit erleben zu dürfen, sind chemikaliensensible Jugendliche von vornherein zwangsisoliert, und ihnen sind krankheitsbedingt die Flügel gestutzt. Somit müssen auch psychische Folgeerscheinungen einkalkuliert werden. Sensorische Hypersensibilitäten spielten eine eher untergeordnete Rolle, sie lagen nur bei etwa einem Prozent der Jugendlichen vor, deuten jedoch an, dass Überlappungen bei Umweltkrankheiten existieren.
Jugendlichen eine Zukunft sichern
Die Ergebnisse der aktuellen Millqvist Studie fordern ein zügiges Umdenken, weil Jugendliche mit schwerer Chemikaliensensitivität meist weder Schule, noch Ausbildung oder Studium beenden können und infolgedessen ein Leben lang stark benachteiligt bis ausgegrenzt sein werden. Gesundheitliche Stabilisierung ist selten zu erwarten, da adäquate Behandlung von Chemikaliensensiblen in der Regel nicht angeboten wird und Rücksichtnahme, obwohl die Krankheit beispielsweise in Deutschland als Behinderung anerkannt ist, nicht stattfindet. Somit ist es chemikaliensensiblen Jugendlichen meist nicht möglich, einen Beruf zu ergreifen, womit ihnen auch jeglicher Anspruch auf Leistungen aus Sozialversicherungen fehlt. Wer keine vermögenden Eltern hat, ist verloren und muss nicht selten aufgrund seiner Krankheit ein Leben unterhalb der Armutsgrenze führen. Die Ergebnisse der schwedischen Studie zwingen zu einem raschen Kurswechsel, um jungen Chemikaliensensiblen zu helfen und auch, um schwerwiegende sozioökonomische Folgen zu verhindern.
Autor:
Silvia K. Müller, CSN – Chemical Sensitivity Network, April 2008
Literatur:
Andersson L, Johansson A, Millqvist E, Nordin S, Bende M., Prevalence and risk factors for chemical sensitivity and sensory hyper reactivity in teenagers, Int J Hyg Environ Health. 2008 Apr 8