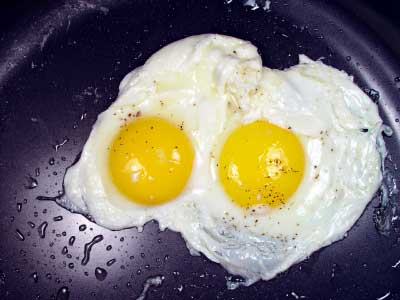Krebs Teil II: Mit dem Grüntee-Ritual und Atmungstechniken Krebs vorbeugen
Grüntee, das hat sicher jeder schon mal gehört, soll gesund sein. Ottilie Otto war schon zu Besuch bei CSN . Wie man sieht, hat sie den Ratschlag beherzigt und geniest ihre Tasse Grüntee. Ottilie tut gut daran, denn Grüntee enthalt nämlich Stoffe, die im Laborversuch nachweislich das Wachstum von Krebszellen hemmen. Epigalloccatechin-gallat oder EGCG ist einer dieser Stoffe. Besonders hohe Konzentrationen von EGCG haben japanische Grünteesorten wie zum Beispiel Sencha und Gyokuro.
Das Geheimnis der Zubereitung von Grüntee
Diese Teesorten sollte man immer frisch aufbrühen und mindestens 8 besser wäre 10 Minuten ziehen lassen, denn so können die Teeblätter große Mengen an Catechinen abgeben. Aufgebrüht wird mit 80 Grad heißem Wasser, nicht mit kochendem Wasser.
Drei bis vier Tassen Grüntee sollte man zu sich nehmen, damit der gesundheitsfördernde Effekt eintritt. Wichtig ist, dass der Tee noch warm getrunken wird und keinesfalls über Stunden in Thermoskannen absteht. Zuhause nimmt man am Besten losen Tee, auf der Arbeit kann es auch ein Teebeutel sein. Noch ein Tipp. Wer von Softdrinks wegkommen will, kann den Teebeutel oder Tee ruhig mehrfach aufbrühen. Das machen die Chinesen traditionell immer. So erhält man ein preiswertes Getränk und stillt den Durst, ohne den Körper mit Zucker zu belasten. Den Anteil an Zucker in der Nahrung zu reduzieren, das ist auch ein Schritt für alle, die dem Krebs den Kampf ansagen wollen. Aber dazu mehr im nächsten Blogbeitrag..
Wem es gelingt, die kleine Teepause entspannt zu genießen, dem sei versichert, dass auch der entspannte Genuss die Gesundheit fördert.
Weltmeister in Erschrecken und Einatmen
Wir sind nämlich Weltmeister im Erschrecken und Einatmen, wie Dr. Ulrich Strunz das mal formuliert hat. Denn „nur diejenigen haben sich fortgepflanzt, die instinktiv einatmen, wenn sie unter Druck geraten…“ Und Dr. Strunz erklärt auch den Kreislauf, der so in Gang gesetzt wird:
„Sie atmen den ganzen Tag ein bisschen mehr ein als aus. Das macht nichts. Der Körper ist ein Regelsystem. Der hebt einfach den pH-Wert im Blut leicht an. Der regelt damit den überflüssigen Sauerstoff, den Sie eingeatmet haben, wieder weg… Das Blöde ist nur: Wenn Ihr pH-Wert im Blut ein bisschen ansteigt, fällt Ihr Kalziumspiegel. Kalzium, das schnelle Stress-Salz… Und wenn der Kalziumspiegel absinkt… wird Ihr Nervenkostüm übererregbar…Es gibt … 100 Meter Bücher über Atemtechnik… Sie können die 100 Meter ganz schnell zusammenfassen: „Atmen Sie aus“…
Sie atmen zurzeit 16-mal in der Minute. Sie müssten aber nur viermal. Das wissen Sie bloß nicht. Sie wissen gar nicht, was das bedeutet: viermal. Sie könnten es herausfinden. Sie nehmen die Uhr und atmen fünf Minuten lang viermal pro Minute. Ist überhaupt keine Kunst. Kann jeder. Wissen Sie, was dann passiert in den fünf Minuten? Ihr Kalziumspiegel steigt dermaßen an… Sie werden plötzlich ein Buddha, in nur fünf Minuten… In fünf Minuten haben Sie Ihr Leben verändert… Sie sind …Ruhig. Souverän“
Atemrhythmus, die Variationen des Herzrhythmus
Der französische Arzt Dr. Servan-Schreiber berichtet über eine interessante Untersuchung aus Italien:
„Seit 15 Jahren interessiert sich Dr. Luciano Bernardi von der Universität Pavia in Italien für die autonomen Rhythmen der Körpers, die die Basis der Physiologie bilden: den Atemrhythmus, die Variationen des Herzrhythmus…, für den Anstieg und Rückgang des Blutdrucks und selbst für Variationen bei Zufluss und Abfluss des Blutes zum und vom Gehirn…“
Als Dr. Bernardis Versuchspersonen eine Litanei von ‚Ave Maria‘ auf Lateinisch zu rezitieren begannen, registrierten die Apparate ein ganz und gar unerwartetes Phänomen: Alle biologischen Rhythmen kamen in Einklang… Dr. Bernardi dachte nicht an eine Wunder, sondern fand eine ganz einfache wie wichtige Erklärung: In Italien rezitiert die Gemeinde den Rosenkranz abwechselnd mit dem Priester. Jede Fürbitte erfolgt mit einer einzigen Ausatmung, die nächste Einatmung findet statt, während der Priester an der Reihe ist. Die Versuchspersonen waren ganz natürlich in ihren vertrauten Rhythmus verfallen. Und dabei hatten sie sich automatisch, ohne sich dessen bewusst zu sein, auf eine Frequenz von sechs Atemzügen pro Minute eingestellt. Das ist genau der natürliche Fluktuationsrhythmus der übrigen Funktionen, die Dr. Bernardi messen wollte (Herz, Blutdruck, Blutfluss zum Gehirn)…
Experiment zeigt den Weg zur inneren Harmonie
Nun war Luciano Bernardis Neugier geweckt, und er sagte sich, wenn das ‚Ave Maria‘ die Physiologie so tief greifend zu verändern vermochte, müssen andere religiöse Praktiken den gleichen Effekt haben…
Berardi erweiterte das ursprüngliche Experiment und brachte Personen, die niemals einen östlichen Glauben praktiziert hatten, das bekannte Mantra des Buddhismus bei: ‚Om-Mani-Padme-Hum‘. Wie beim Yoga lernten sie, mit voller Stimme jede Silbe des Mantra zum Klingen zu bringen…
Bernardi beobachtete genau die gleichen Resultate wie beim ‚Ave Maria‘: Die Atmung stellte sich von selbst auf einen Rhythmus von sechs Atemzügen pro Minute ein, und entsprechend erfolgte die Harmonisierung – die ‚Kohärenz‘- der anderen biologischen Rhythmen.
Dr. Bernardi staunte und fragte sich, ob die unerwartete Übereinstimmung zwischen so unterschiedlichen religiösen Praktiken vielleicht mit gemeinsamen Wurzeln zusammenhängen könnte. Tatsächlich scheint es, dass der Rosenkranz von den Kreuzfahrern nach Europa gebracht wurde, die ihn von den Arabern übernommen hatten, und die Araber hatten ihn wiederum von tibetischen Mönchen und indischen Yoga-Meistern. Die Entdeckung von Praktiken, die biologische Rhythmen im Interesse von Gesundheit und Wohlergehen harmonisieren, scheint demnach weit in die Geschichte zurückzureichen. “
Richtig atmen reguliert Funktionsabläufe
Dr. David Servan-Schreiber weist darauf hin, dass ein Zustand der „Kohärenz“ der Gesundheit in vielfältiger Weise zuträglich ist:“ Es bewirkt vor allem
- ein besseres Funktionieren des Immunsystem
- seine Verminderung von Entzündungen
- eine bessere Regulation des Blutzuckerspiegels
- genau die drei Hauptfaktoren, die die Entwicklung von Krebs bremsen.“
Bremsen wir also den Krebs wie Experten es raten mit dem Atemrhythmus und den Wirkstoffen des Grüntees und morgen geht’s weiter, dann erfahren wir zusammen mit Ottilie, die nichts mehr als ihre Muffins am Morgen liebt, welche Nahrungsmittel Krebs begünstigen, damit wir sie meiden können,
Eure Juliane
Literatur:
Dr. Ulrich Strunz, Praxisbuch Mental Programm, Seite 104
Dr. David Servan-Schreiber, Das Anti-Krebs-Buch, Seite 254