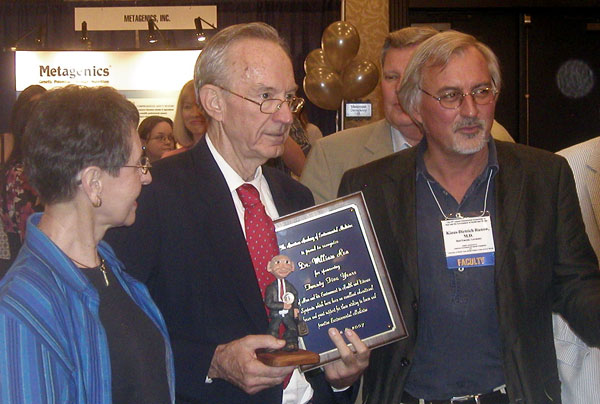Der nachfolgend wiedergegebene Vortrag wurde von Dr. Peter Binz, Neurologe und Umweltmediziner aus Trier, am 21.Oktober 2007 auf Einladung an der Evangelischen Akademie Iserlohn bei Schwerte gehalten. Die Tagung stand unter dem Motto „Verkaufte Gesundheit – Krankes System?“ Im Anschluss des Vortrages wurde er von einer Arztkollegin spontan für einen Zivilcouragepreis vorgeschlagen. Was sie nicht wusste, war, dass Dr. Binz für seinen Mut und seinen Widerstand gegen all jene, denen ein Menschenleben nichts wert ist, bereits für den Zivilcouragepreis der Solbach-Freise Stiftung nominiert war. Dieser Preis wurde ihm kurz darauf verliehen.

Alternativen zu dem heutigen Gesundheitssystem aus der Sicht der Praxis und der Patienten
Tagung: Verkaufte Gesundheit – krankes System?
Evangelische Akademie Iserlohn
Schwerte, 21.10.2007, 10.45 Uhr
__________________________________________________
Neue Wege:
Um neue Wege zu finden ist es sinnvoll, durch Beispiele aus der eigenen Praxis zu beschreiben,
- wie Arbeitsschäden entstehen
- wie man mit den Geschädigten umgeht
- wie man sich verteidigen kann
- wer einen dabei zu hindern versucht
- wer einem hilft
Zu denen, die am meisten zu sagen haben: Die Krankenkassen
Fast alle sind in den Pflichtkrankenkassen versichert, die z. B. in ihrer Werbung versichern: „wir tun mehr“.
Es ist aber selten, dass Krankenkassen helfen bei der Aufklärung der Arbeitsschäden und der Giftschäden und bei der Durchsetzung der ohnehin geringen Ansprüche der Geschädigten, meist wird sogar versucht, die Berufsarbeitsverfahren zu blockieren, obwohl nach den gesetzlichen Regeln die Krankenkasse verpflichtet ist, bei der Aufklärung mitzuhelfen. Sie darf auch nicht aus den Beiträgen ihrer Mitglieder die Schäden bezahlen, die durch Arbeitsgifte entstanden sind. Um die Betroffenen und ihre Familien zu entmutigen und zur Aufgabe der BG-Verfahren zu bewegen, gibt es ein paar immer wiederkehrende Methoden:
– Sobald die Diagnose der toxischen Schäden in der Krankmeldung auftaucht T65.8, wird der Patient zur Krankenkasse bestellt und dort redet man ihm zu, endlich zu einem „richtigen Arzt“ zu gehen, bei mir seien doch alle vergiftet.
Es gibt dann auch Versprechungen: Meine Krankmeldungen werde man nicht anerkennen und es gebe „Schwierigkeiten“. Wenn sie sich aber von einem anderen Arzt, z. B. von einem Orthopäden krankschreiben ließen, dann könnten sie sich der Zahlungen sicher sein. Viele Patienten gehen darauf ein. Es gibt ja viele, die von Natur aus aber auch durch ihre Hirnschäden in ihrer Urteilsfähigkeit gestört sind, oder die sich durch ihre Schwäche nicht mehr verteidigen können.
Eine Reihe der Patienten werden also recht geräuschlos auf diese Weise am Berufskrankheitenverfahren vorbeigeführt und kommen „so“ in die Rente. Andere wehren sich und dann kommt die prompte Bestrafung durch die Krankenkasse: man wird zum Medizinischen Dienst bestellt. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen in Trier hat seit Jahrzehnten so gut wie nie die Diagnosen der toxischen Schäden, vor allem im Beruf, bestätigt. Er müsste dann ja auch bestätigen, dass z. B. die toxischen Belastungen der Schuhfabrik Romika seit dem Kriegsende weder chemisch noch medizinisch angemessen untersucht und beurteilt wurden, vom Sozialen ganz zu schweigen. Also steht stereotyp in den MDK-Gutachten, es gäbe „keine Anhaltspunkte für eine Vergiftung“, wobei besonders der wichtigste „Anhaltspunkt“ bei der Untersuchung weg gelassen wird, nämlich die toxische Vorgeschichte.
– Der MDK und die Kassen gehen auch nicht darauf ein, dass sie untrügliche Beweise für die Schäden haben, die ganz unabhängig sind von Arzt und Patient, nämlich die Statistik über die Krankheiten und die Lebenserwartung, etwa der Schuharbeiter, der Winzer, der Schreiner, der Schweißer etc. Bewusst werden also diese Zahlen jahrzehntelang geheim gehalten, man kann fragen, so oft man will, auch bei den BGs oder Aufsichtsbehörden. Jeder Geschädigte bleibt so ein „Einzelfall“.
– Ein weiteres Machtmittel der Krankenkassen ist die Entsendung der Patienten in die sogenannten „Heilverfahren“. Für toxische Schäden gibt es keine naturwissenschaftlich begründeten Heilverfahren außer der Expositionsvermeidung. Das war ja schon unseren Großvätern bekannt, die vernünftigerweise die Sanatorien ans Meer oder ins Hochgebirge gelegt haben, also an frische Luft aber leider schon damals mit Desinfektionsmitteln.
In den Heilverfahren wird dann versucht, den Patienten davon zu überzeugen, dass er psychosomatisch erkrankt sei oder eine Anpassungsstörung habe.
Psychosomatisch ist die Nachfolgebezeichnung für mehrere Benennungen, die inzwischen selten sind wegen ihrer offensichtlich beleidigenden Unsinnigkeit, früher nannte man diese Leute „verrückt, hysterisch“ oder „Simulanten“, besonders letztere Eigenschaft wird ja auch heute noch streng erforscht: kann der Patient dem Arzt schnell die Treppe hinauf folgen obwohl er über Muskelschäden klagt, hat er Ölflecken an den Händen, geht er abends Bier trinken in Gesellschaft, verhält er sich in der Therapiegruppe intelligent oder dominant oder weinerlich, – dann steht jeweils der Verdacht nahe, dass er betrügt.
Gerne gesehen ist dagegen, wenn er die psychosomatischen Erklärungen für die Erkrankung annimmt, die man ihm vorsagt. Psychosomatik beruht auf der merkwürdigen Vorstellung, dass es Funktionen der Intelligenz oder Affektivität gebe, die außerhalb des Gehirns sich abspielen in der sogenannten Psyche und die dann aber auf den Körper zurückwirken. Psychosomatisch ist eine der Konstruktionen, mit der man alles und logischerweise daher gar nichts erklären kann. Aber Psychosomatisches hat der Patient wenigstens selbst zu verantworten.
Auch im Umgang mit der Chemie des Alltags sind die Kurkliniken oft recht unbedarft: Die Patienten werden z.B. zum Training in Chlorbäder geschickt, die sind nun mal lange in Gebrauch, auch wenn sie seit jeher mit dem Gift desinfiziert werden, das immer noch die meisten Schäden macht. Dazu kommen noch die Putzmittel, die Duftstoffe, der Zigarettenrauch, die staubigen Teppiche etc. Es gibt wenige lobenswerte Kliniken, in denen überempfindliche Patienten mit möglicht wenigen Auslösern und biologisch gesund leben können.
Eine wesentliche Rolle bei der „Erklärung“ der Schäden spielt auch der Alkoholkonsum der Geschädigten: Einige werden in verschiedenen Berufen Alkohol abhängig, z. B. die Schweißer, die Keramikarbeiter etc. In der Firma V&B gab es in den Hallen mit gefährlichen und Durst verursachenden Stäuben überall Bierautomaten, die später von den BG’s verboten werden, aber die Ursachen für den Bierdurst wurden nicht geändert. Unsere Vorfahren redeten von „Trinkerberufen“. Ein Gift zieht oft das andere nach sich, viele Gifte sind zumindest anfangs aktivierend und euphorisierend und können sich gegenseitig ersetzen.
Aber auch wenn ein Alkoholabusus erwiesen ist, dann darf man nicht vergessen, die Ursachen zu erwähnen, das sind häufig toxische Belastungen. Andererseits: viele Vergiftete sind überempfindlich gegen Ethanol und bei etwa sehr geringen Mengen haben sie massive Beschwerden wie etwa bei einem schweren Rausch.
Viele der toxisch geschädigten Patienten trinken daher keinen Alkohol. Sie vertragen ihn nicht weil sie überempfindlich geworden sind durch ihre toxischen Belastungen.
Anders ist es beim Nikotin. Nikotin ist ein anregendes Antidepressivum, es kann Konzentration, Stimmung und Kurzzeitgedächtnis verbessern.
Manche können Zigarettenrauch nicht ertragen und rauchen nicht. Viele berichten aber, dass sie jeweils viel mehr rauchen wenn sie in höherer toxischer Belastung arbeiten oder ihre Konzentrationsleistungen mit den Jahren nachlassen. Die Zahl der täglichen Zigaretten gibt Auskunft darüber, wann die Arbeit hoch toxisch belastet war oder besonders anstrengend war. Am meisten rauchen die Chinesen und die Bulgaren.
Nikotin und Alkohol werden als selbst zu verantwortendes Fehlverhalten eingeschätzt. „Entwöhnen“ kann man jedoch nur mit menschenverträglichen Arbeits- und Lebensumständen der Unterschicht.
In Abschlussberichten der Reha-Verfahren gibt es dann regelmäßig Diagnosen, die möglichst weit von der Immunotoxikologie entfernt sind, also die Anpassungsstörung, die chronische Depression ohne Ursache, die rheumatischen Gelenkschäden und wenn einmal der Verdacht auf Intoxikation bestätigt wird, ist das schon das Höchste. Die vollständige Aufklärung der Berufsschäden gibt es so gut wie nie.
Es gibt zwei lobenswerte Ausnahmen: die Klinik in Bredstedt und das Krankenhaus in Neukirchen bemühen sich, Schäden bei Überempfindlichkeiten durch toxische Belastungen aufzuklären und in beide Häuser schicken die Versicherungen daher nur widerstrebend.
Die „normalen“ Kurkliniken sind nun einmal von ihren Geldgebern zur Effektivität angewiesen und das heißt: arbeitsfähig oder gesund entlassen oder zumindest Selbstverschulden nachzuweisen.
Die Berufsgenossenschaften
Sie tragen einen Vertrauen erweckenden Namen, wer möchte nicht gerne „Genosse“ sein, und ihre Hauptverwaltung liegt in St. Augustin, aber da fällt einem schon das Karnevalslied ein.
Die Berufsgenossenschaften haben seit Generationen fast immer gewonnen, sie konnten etwa 95 % der Verfahren für sich entscheiden. Die meisten Ärzte, die zur Meldung der Berufskrankheiten verpflichtet sind, erstellen diese Meldungen nicht, meist aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit, aber auch aus Angst. Es ist daher klar, dass kaum einer der geschädigten Arbeiter wenigstens eine Entschädigung bekommt, die ohnehin meist sehr gering ist.
Das wichtigste Mittel für den Erfolg bei den BG’s sind ihre Gutachterschulen. Über Generationen wurden die leitenden Posten in der Arbeitsmedizin mit den Schülern der gleichen Schule besetzt. Kein Wunder, dass sie in ihren Gutachten immer zu den gleichen Schlüssen kommen, mit den stets gleichen Auslassungen zur Tatsache und Standard-Formulierungen „beweisen“, dass keine Berufskrankheiten vorliegen. Die wichtigsten Lehrstühle stehen in Erlangen, München, Bochum und Heidelberg.
Weiter zum Erfolg verhalfen die „Lehrbücher“ wie der Valentin – Mehrtens, die ständig in den Urteilen zitiert werden, obwohl die Fachliteratur schon längst die oft makabren Behauptungen in diesem System widerlegt hat, zum Beispiel, dass Lösungsmittelschäden spätestens nach 2 Jahren ausgeheilt sein müssen, und dass sie auch erst eintreten, wenn man mindestens 10 Jahre hohen Konzentrationen ausgesetzt war, die die gesetzlich sicheren Grenzwerte überschritten haben.
In Wirklichkeit stehen die Lösungsmittel schon seit jeher auf der IDLH-Liste (Immediately Dangerous to Life and Health), d. h. in kürzester Zeit, (30 Minuten) können sie zu schweren bleibenden Schäden oder zum Tod führen. Darüber hinaus ist ein großer Teil der immunotoxischen Schadensabläufe Dosis- unabhängig, d. h., wenn eine Überempfindlichkeit eingetreten ist, dann kann ein einziges Molekül die Immunkaskade auslösen, die immer zu Kollateralschäden führt.
Trotz dieser fundamentalen gefährlichen Fehler werden in den Gerichtsurteilen die Gutachten aus dieser Schule als wissenschaftlich verlässlich und „verbindlich“ erklärt.
Darüber hinaus gibt es noch ein paar Praxen niedergelassener Ärzte, die von den BG’s aber auch von einigen Gerichten herangezogen werden – wenn alles für das Recht der geschädigten Arbeiter spricht und eindeutige Beweise vorliegen: auch diese werden dann noch versenkt mit oft ungeheuerlichen Behauptungen dieser Gutachter, die wissen, dass ihnen nichts passieren kann, wenn sie alle medizinischen und rechtlichen Regeln übertreten.
Viele Patienten, Rechtsanwälte und Ärzte haben natürlich versucht, sich gegen diese Falschgutachter zu wehren, selten mit Erfolg. Die Gutachterliste der BGs ist immer noch die gleiche wie vor 25 Jahren.
Eine wirksame behördliche oder juristische Aufsicht, die das Gröbste bei Berufsgenossenschaften und ihre Gutachtern verhindert gibt es bisher nicht. Es besteht ein festes Netzwerk zwischen Krankenkassen und Berufsgenossenschaften und Gutachtern, und vielen Gerichten, das nicht zu erschüttern ist und offensichtlich starke politische und finanzielle Unterstützung hat.
Die Strafjustiz
Bei den meisten toxischen Schäden im Beruf, liegt zumindest grobe Fahrlässigkeit vor, mit Körperverletzung oder Tötung, dann sind auch alle Beteiligten zur Meldung an die Staatsanwaltschaft verpflichtet.
Am Anfang der Aufklärung der sehr vielen Geschädigten z. B. bei der Schuhfabrik Romika wurde zwar zunächst ein Zivilverfahren gegen mich eröffnet, wegen „Verunglimpfung“ dieser eingebürgerten Schuhfabrik mit 2500 Arbeitsplätzen, aber dann wurde doch ein Strafverfahren eingeleitet gegen einige Funktionäre aus den unteren Rängen, sie mussten ein Busgeld von wenigen tausend DM bezahlen und danach wurde in wenigen Tagen das Verfahren eingestellt.
In den folgenden Jahrzehnten habe ich, wie es nun einmal vorgeschrieben ist, noch viele Meldungen auch an die Staatsanwaltschaft weitergegeben, etwa die Todesfälle aus der Romika, die Toten aus der Fabrik für Plastikbehälter in der Eifel, die Totenlisten aus den längst aufgelösten Auer-Werken, die hier in Trier Gasmasken etc. herstellten und auch viele einzelne Schäden und Todesfälle aus kleineren Firmen. Seit etwa 15 Jahren gab es nicht einmal eine Eingangsbestätigung, nur von der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken kam einmal oder zweimal eine kurze Mitteilung, dass die Meldung eingegangen sei, das Ermittlungsverfahren aber gleich wieder eingestellt werde, wenn ich keine „weiteren Beweise“ vorlegen könne. Die Staatsanwaltschaft hat also selbst nie weiter nachgeforscht.
Die Kassenärztliche Vereinigung
Die KV ist gesetzlich verpflichtet zur Sicherstellung einer angemessenen medizinischen Betreuung. Die KV in Trier hat in den letzten 15 Jahren unter ihren Leitern Sauermann und Müller sich darum bemüht, zur Vermeidung weiterer Arbeitsschäden meine Praxis zu schließen. Einzelheiten zu den wenig erfreulichen und sehr teueren Verfahren will ich hier nicht ausbreiten. Es ist möglich, dass man jetzt bei der KV in Koblenz und in Mainz nüchterner und sachkundiger urteilt, wir wollen es hoffen.
Auch die Aktionen meist der KV, ab und zu auch des früheren Kammer-Präsidenten Prof. Krönig, mit den offensichtlichen Verbindungen zu den Berufsgenossenschaften, Krankenhaus, Kassen und Arbeitgebern haben dazu beigetragen, dass kaum noch ein Arzt Arbeitsschäden meldet obwohl bei näherem Hinsehen dieses Übersehen der Arbeitsschäden nur zu weiteren Schäden und zu endlosen Spätschäden führen wird, nicht zuletzt deswegen, weil auch das genetische Material der Familie geschädigt wird, d. h. ein Teil der Schäden wird weiter vererbt und Genschäden sind nicht reparabel, sie hören also erst auf, wenn es keine Nachkommen mehr gibt.
Die Kollegen unter den Ärzten
Es gibt durchaus Mediziner, die auf der Seite der geschädigten Arbeiter und ihrer Ärzte stehen, aber es sind nicht sehr viele. Sie sind meist Mitglieder von IGUMED, DGUHT, ÖÄB. Man kennt sich von den Tagungen. Wenn kleine Gruppen von Ärzten zusammenarbeiten, etwa der Neurologe, der HNO-, der Augenarzt und der Röntgenarzt bei der Dokumentation von Hirnleistungen, dann ist mindestens unter vorgehaltener Hand die Bezeichnung „Mafia“ fällig.
Außer dem Verantwortungsgefühl gibt es wenig, was einen „anziehen“ könnte bei der Aufklärung von Arbeits- oder Unfallschäden. Die Gebührenordnung ist z. B. so eingerichtet, dass man garantiert nicht zuviel verdient mit der nicht versicherungshörigen Arbeitsmedizin: Das ist nicht weiter schlimm, aber die persönlichen Herabsetzungen bis zur Kriminalisierung treffen einen schon.
Zu den Leuten und Gruppen, die helfen: Die Familie
Wenn ein Maler sein Verfahren gegen die BG gewinn, so steckt dahinter meist eine resolute Ehefrau die sich nicht von der Autorität der Funktionäre oder den akademischen und juristischen Titeln verblüffen lässt. (Ich denke übrigens, ich habe so eine Frau).
Oft sind die Patienten aber auch alleine, entweder weil sie schon geschädigt waren in der Zeit in der man sonst eine Partnerschaft sucht, viele bleiben Junggesellen. Viele sind geschieden, weil durch die ständigen Belastungen für die Familie und ihre schlechten Zukunftsaussichten, aber auch durch ihre zunehmende Aggressivität oder Passivität die Ehen zerstört werden. Der Leistungsabfall und die charakterlichen und affektiven Veränderungen sind eine häufige Ursache für Einzelgängertum und Scheidungen.
Viele verzichten auf Kinder, weil sie ihren Kindern das Leben, das sie erdulden mussten, nicht wünschen. Häufig gibt es keine Kinder weil in Giftberufen die Frauen nicht schwanger werden oder Aborte haben oder behinderte Kinder zur Welt bringen, das alles um so häufiger, je länger sie im Gift gearbeitet haben, z.B. Krankenschwestern, Schuharbeiterinnen, aber auch Lehrerinnen in belasteten Schulen.
Wichtig sind natürlich die Kinder, wenn es welche gibt, um die Verfahren durchzuhalten mit der Gemütsstärkung der durch die Kleinen und den Computer- Justiz- und Chemiekenntnissen der Großen.
Ich freue mich also, wenn mehrere Mitglieder der Familie und auch Freunde mit zur Untersuchung kommen, während die Gutachter der Versicherungen es regelmäßig versuchen, solche „unbeteiligten Angehörige“ oder Freunde bei der Untersuchung herauszuhalten, man will keine Zeugen.
Außer der Familie gibt es natürlich noch die Kameradschaften und die Genossenschaften im wahren Sinn des Wortes vor allem als Selbsthilfegruppen, sie tauschen ja ihre Kenntnisse über die Arbeitsstoffe, die Rechtsanwälte, die Gutachter und die Spätfolgen aus.
(Vor einigen Tagen hat Herr P. berichtet: seine Schwägerin, die früher 10 Jahre bei der Romika gearbeitet hatte, habe er nach Jahren endlich überreden können, zu mir zur Untersuchung zu kommen: Er habe ja 1981 in seinen 20er Jahren mit 45 anderen im gleichen Alter zusammen bei der PVC-Fabrik Pegulan in Konz zu arbeiten begonnen, von denen lebten jetzt noch 3.)
Die Psychologen
Schon immer hat ein Psychologe in der Praxis mitgearbeitet, seit 15 Jahren ist es Herr Klein. Die psychologische Leistungsuntersuchung ist die wichtigste objektivierbare und reproduzierbare Untersuchung um Veränderungen der Hirnleistung festzustellen, sie wird weltweit mit den gleichen Tests durchgeführt.
Die beliebten Behauptungen, der Patient simuliere oder es sei alles nicht so schlimm, können mit der Psychometrie widerlegt werden. Am frühesten betroffen bei Hirnschäden sind meist Konzentration und Geschwindigkeit sowie Kurzzeitgedächtnis und der Nachzeichnung von geometrischen Formen.
Eine Reihe von Patienten brauchen auch psychologische Unterstützung in ihrer Niedergeschlagenheit und Unsicherheit. Zu länger dauernden Psychotherapien überweisen wir an niedergelassene Psychologen, bei denen ändert sich auch das Krankheitsverständnis: Wenn sie früher in ihrer Ausbildung die Schäden und Veränderungen mehr auf psychische und soziale Mechanismen zurückführten, erkennen sie immer mehr als Ursache die organischen Hirnschäden. Es ist oft für alle Beteiligten belastend, vor allem wenn man bei jüngeren Menschen schwere Hirnschäden feststellt und den unaufhaltbaren weiteren Abfall über die Jaher, aber gerade diese Menschen brauchen am meisten Unterstützung.
Die Rechtsanwälte
Die meisten sind korrekt, hilfsbereit und hören auch zu, was man so als Arzt vorbringt, (von Richtern kann man das nicht so oft behaupten, die haben alte Zöpfe in den Verfahren oft noch nicht abgeschnitten). Viele Rechtsanwälte geben sich sehr viel Mühe bei relativ geringem Verdienst in den Sozialgerichtsverfahren. Alle wissen, wie gering die Chancen sind und wie erdrückend oft die Belastungen für die Patienten, ihre Familien und nebenbei für ihre Ärzte.
Viele Berufskrankheitenverfahren gehen über Jahre und Jahrzehnte, die Romika-Verfahren sind bis heute z. T. noch nicht abgeschlossen. Ab und zu gewinnt einer seine 20 % MdE-Rente, mehr ist nicht drin. Ein anderer mit den gleichen Schäden von der gleichen Arbeitsstelle, der sich aber aufmüpfiger im Verfahren gewehrt hat, kann noch Jahre warten.
Die Gewinnrate der BG’s von ca. 95 % ist schon erwähnt. Die Wahrscheinlichkeit zu „gewinnen“ wechselt auch mit der Zeit und der Politik: In den 90er Jahren waren Berufsgenossenschaften und Sozialgerichte von den Beweisen für die bisher „unbekannten“ Schäden so verblüfft, dass z.B. alle von den etwa 20 Geschädigten aus der Tierkörper¬beseitigungsanstalt Rivenich anerkannt und entschädigt wurden, dort hatte man unter seltsamen physikalischen, chemischen und neurologischen Vorstellungen geglaubt, man könne gefahrlos das Fett aus dem erhitzten und gemahlenen Fleisch der Tierkadaver mit dem Lösungsmittel Perchlorethylen herauslösen und nachher wieder das PER zurückgewinnen.
Aber alle Dichtungen und Kugellager der Anlage wurden regelmäßig von PER aufgelöst. Die Arbeiter stiegen bei der Reparatur unbesorgt in die großen Behälter. Einer stand aber draußen und wenn der drinnen anfing zu singen oder Sternchen zu sehen, wurde er herausgeholt und der nächste ging hinein. Man hielt das für einen ungefährlichen kleinen Rausch.
Zu mir in die Praxis kamen die Beschäftigten auf dringenden Rat der Tierärztin, die für die Tierkörperbeseitigungsanstalt zuständig war, die hatte sich kundig gemacht im Gegensatz zu der Schulmedizin und den „Kassen“.
Es war also die alte Geschichte, zunächst ungenügende Information, Euphorisierung und Aktivierung durch die Lösungsmittel, später zunehmende vielfältige Schäden, zunächst der Gehirnleistung, dann des Verhaltens, zum Schluss meist Demenz und Krebs, fast alle sind inzwischen tot.
Nachdem man aber nach den „Ereignissen“ in Rivenich ausrechnen konnte, was in der gesamten rückständigen Lösungsmittelindustrie z. B. in Reinigungen angerichtet hatte wurden die oben genannten Gutachter- und Verfahrensmechanismen entwickelt. Es wurden nur noch sehr wenige Lösungsmittelgeschädigte entschädigt.
Dabei spielt es inzwischen keine Rolle mehr, ob jemand für Laien erkennbar sehr schwer körperlich und geistig geschädigt ist: 23 Jahre hat Herr M. als Maler gearbeitet hat. Viele einzelne Bericht und sogar ein eindeutiges Gutachten für ihn bei Frau Prof. Elsner und dem Psychologen Dr. Ruß in Frankfurt wurde von der BG „abgelehnt“ und sie schickt die altbekannte Gutachterliste mit ihren Spitzen-Leuten: Prof. Triebig, Prof. Norpoth und Prof. Bolt.
Es gibt aber auch Hoffnungen: Herr Sch. kam erstmals 1984 hierher, er beschrieb seine Karriere als Maler seit der Jugend: er hatte eine arme allein erziehende Mutter, daher trotz guter Leistungen Malerlehre, das Geld fehlte für Weiterbildung.
Mit 16 J. Anstrich von Sprossenfenstern in einem restaurierten Schloss mit dem kräftigsten Weiß, der Name Bleiweiß sagte ihm zunächst nichts.
Tage später die mit Sicherheit zu erwartenden Symptome: Bleikoliken, aber Diagnose im Krankenhaus: „geplatzter Blinddarm“ und Eröffnung der Bauchhöhle, worauf er beinahe gestorben wäre. Er hat sich erholt, mit viel Arbeit Karriere gemacht, er hat eine Firma mit mehreren Angestellten und konnte sich ein paar Mehrfamilienhäuser bauen.
Dann kam langsam die Zeit, in der er „alles vergessen hat“, wenn er z. B. eine Besorgung von Arbeitsmaterialien von Limburg nach Frankfurt fahren wollte, hatte er auf halber Strecke vergessen, was er eigentlich in Frankfurt wollte. Der Niedergang der Firma und der Verlust seines gesamten Vermögens waren die Folge.
Er hat aber immer noch andere in ähnlichen Situationen unterstützt und zu mir „geschleppt“, z. B. einen ähnlich erkrankten Türken, der die Trümmerfelder der früheren Hoechst abgeräumt hatte.
Die Meldung einer Berufskrankheit des Herrn Sch. habe ich 1994 erstellt, die Verfahren in allen Instanzen hat Herr Sch. verloren, obwohl oder gerade weil ich ihn ständig unterstützt habe.
Aber 2006 kam die Entscheidung des Bundessozialgerichtes: das Verfahren sei wieder aufzunehmen. Sogar mein Name in dem Urteil wird einmal kurz erwähnt. Herr Sch., bei dem inzwischen die sehr starke Hirnleistungsstörung mit PET und Kernspintomogramm nachgewiesen ist, wurde schließlich unter der Diagnose „Alzheimer“ eingeordnet. Mit „Alzheimer“ werden ja gerne Arbeitsschäden verschleiert.
Herr Sch. hat sich auf meinen Rat hin dann bemüht, das aufzuklären, was Prof. Alzheimer übersehen hatte: Er hat die mit 56 Jahren gestorbene Frau Deter zu Lebzeiten nicht gefragt oder hat zumindest nicht dokumentiert, wo sie gelebt hat und wo sie und ihr Mann gearbeitet haben.
Herr Sch. hat inzwischen dank seiner für kurze Zeit noch funktionierenden Leutseligkeit und Aktivität Stadtpläne und Adressen der Firmen und Familien in der Umgebung der Wohnung der Frau Deter beschafft, sie hat in der Nähe einer Firma zur Asbest- und Teerverarbeitung gewohnt und vielleicht auch dort gearbeitet. Auch die erste Erdölindustrie in Frankfurt produzierte in der Nähe. Der große Schornstein steht noch als Kulturdenkmal.
Ende